»…wenn die Demokraten die Regulierung der Staatsschulden verlangen,
verlangen die Arbeiter den Staatsbankrott.«
Karl
Marx / Friedrich Engels
Der
drohende Bankrott Griechenlands hat die Lohnabhängigen ins Zentrum
des Geschehens gerückt. Er blamiert nicht nur die seit Monaten
beschworene Stabilisierung der Weltwirtschaft als eine vorschnelle
Diagnose, sondern führt vor allem in aller Drastik vor Augen, dass
sie von der weiteren Opferbereitschaft der Ausgebeuteten abhängt und
auf diese nicht überall gezählt werden kann. Das ist es, was den
Fall Griechenland zum Menetekel macht und hierzulande eine aufgeregte
Kampagne gegen die „Pleite-Griechen“ (Bild)
auslöste, die „über ihre Verhältnisse gelebt“ und damit nicht
nur den eigenen Staat, sondern auch den Euro in Gefahr gebracht
hätten – und die sich zu allem Überfluss nun, in der Stunde der
größten Not, nicht etwa willig in ihr Schicksal staatlich
verordneter Verarmung fügen, sondern lieber auf die Barrikaden
gehen. Denn beim großen Gerangel um die Zukunft des griechischen
Staates, das unter den Staatslenkern und Wirtschaftsführern Europas
ausgebrochen ist, steht eines nicht zur Debatte: die Notwendigkeit
harter Einschnitte in die Existenzmittel der lohnabhängigen
Bevölkerung, ein Programm, das der britische
Economist kürzlich
mit der Nüchternheit der aufgeklärten Bourgeoisie in vier Worte
fasste: Now
comes the pain.
Nicht nur in Griechenland schlagen nun die Kosten der staatlichen Kriseneindämmung, mit der in den letzten anderthalb Jahren ein System-Crash verhindert werden konnte, voll zu Buche. Sie war nur um den Preis einer aberwitzigen Staatsverschuldung zu haben, die sich immer unübersehbarer selbst zum nächsten Krisenherd entwickelt und neben Griechenland auch Portugal, Spanien und andere Länder mit einem Bankrott bedroht. Es erinnert an den Rettungsschwimmer, der so weit ins Meer hinausschwimmen muss, dass er selbst abzusaufen droht; so zerplatzt das links wie rechts gehegte Traumbild des souveränen Staates, der mit sachkundigem Blick fürs Ganze die wild gewordene Ökonomie zähmen könne. Die keynesianischen Maßnahmen seit Beginn der Krise – die Konjunktur-programme, die Stützung des Massenkonsums durch Abwrackprämien und dergleichen, der Beschäftigung durch Kurzarbeit – bedeuten nur eine Verschiebung, nicht aber eine Lösung der Krise. Sie gehen mit einem Protektionismus und Nationalismus einher, der gegenwärtig immer bedrohlichere Formen annimmt. Diese zeigen sich im Kampf zwischen dem deutsch-französisch dominierten EADS-Konzern und dem US-Unternehmen Boeing um einen Milliardenauftrag des Pentagon, ebenso im Streit um die deutschen Exportüberschüsse oder die chinesische Politik, den Kurs der eigenen Währung niedrig zu halten. Durch keynesianische Maßnahmen haben sich Staatsdefizite aufgetürmt, die früher oder später, wenn kein Konjunkturwunder geschieht, nur auf Kosten der Lohnabhängigen wieder abgebaut werden können. Einerseits verdeutlicht diese Situation, dass die Marktökonomie nicht in der Lage war, alleine einen Crash zu vermeiden; andererseits, dass die Eingriffe des Staates die alten Probleme nicht gelöst, sondern nur durch neue ersetzt haben: Weder der liberale Glaube an die selbstheilenden Kräfte des Marktes noch das keynesianische Vertrauen auf staatliche Eingriffe bieten einen dauerhaften Ausweg aus der Krise.
Enthielten die Vorschläge der reformistischen Linken, die Krise des Kapitals durch „Umverteilung von oben nach unten“, durch eine Renaissance der alten Sozialdemokratie und etwas Finanzmarktregulierung zu überwinden, auch nur einen Funken Sachverstand, so würde die griechische Regierung keine Sekunde zögern, sie in die Tat umzusetzen, um der Konfrontation mit dem einheimischen Proletariat aus dem Weg zu gehen. In der Tat gibt sie sich alle Mühe, auch die steuerhinterziehenden Besserverdienenden zur Kasse zu bitten. Aber es geht nicht nur darum, Löcher im Staatshaushalt zu stopfen. Die Krise der griechischen Staatsfinanzen verweist auf die Schwäche der griechischen Wirtschaft, und eben dies zwingt den Staat, den Bluthund zu spielen. Was die Athener Regierung derzeit herbe Risikoaufschläge kostet, wenn sie ihre Haushaltslöcher durch Anleihen zu stopfen versucht, ist das geringe Vertrauen der Finanzwelt in die griechische Wirtschaft, aus der die Mittel zur Kredittilgung letztlich abgeschöpft werden müssen. Mit Bankgewerbe, Tourismus und Handelsschifffahrt hat die Krise mit voller Wucht eben die Sektoren erwischt, die Griechenland in den letzten Jahren ein bescheidenes Wirtschaftswachstum bescherten; eine weltmarktfähige Industrie existiert praktisch nicht und der tatsächlich aufgeblähte Staatsapparat, der einen Teil der überschüssigen Arbeitskraft absorbiert, ist unproduktiv, nicht Erzeuger, sondern Konsument von Mehrwert.
Schon lange vor der Krise waren Staat und Bourgeoisie nach Kräften darum bemüht, die Konkurrenzfähigkeit ihres Landes durch Privatisierungen und die Forcierung prekärer Arbeitsverhältnisse zu verbessern – und erhielten mit der Revolte vom Dezember 2008 eine erste Antwort der Proletarisierten. Der griechische Dezember, ausgelöst von tödlichen Polizeikugeln auf einen Jugendlichen, war die Sache der jungen Prekären, von Jobbern, Studentinnen, Schülern, Migrantinnen. Um Tausende zu Straßenkämpfen und Besetzungen zu bewegen, brauchte es nicht erst einen Absturz der Konjunktur; für einen wachsenden Teil des Proletariats bestanden die Aussichten ohnehin nur darin, sich lebenslänglich mit ungesicherten Drecksjobs durchzuschlagen. Während die Revolte auf diesen Teil begrenzt blieb, verfinstern sich nun mit der anlaufenden Sparpolitik die Aussichten auch der anderen, vergleichsweise besser gestellten Teile der lohnabhängigen Klasse: die Löhne im öffentlichen Sektor werden um zehn Prozent gekürzt, die ohnehin spärlichen Renten eingefroren, die Mehrwertsteuer erhöht; Pläne zur Lockerung des Kündigungsschutzes und zur Erhöhung des Renteneintrittsalters liegen bereits auf dem Tisch. Zu bedenken ist dabei, dass das Überleben in Athen nicht billiger ist als in Frankfurt, die tristen Löhne dort jedoch schon heute etliche Staatsangestellte dazu zwingen, nach Dienstschluss einem Zweitjob nachzugehen.
Der griechische Staat findet sich so eingekeilt zwischen einem Vertrauensverlust der Finanzmärkte und einem Legitimitätsverlust bei den Lohnabhängigen: Ist er bei seinen Sparprogrammen nachgiebig, droht ihm die Zahlungsunfähigkeit; treibt er sie voran, riskiert er Streiks und Straßenschlachten. Griechische Genossinnen berichten von einem spürbaren Einfluss der Revolte vom Dezember 2008 auf die gegenwärtigen Proteste: Gewerkschaftsdemonstrationen gehen in Plünderungen über, Straßenkämpfe bleiben nicht auf das antiautoritär-anarchistische Milieu beschränkt und der Gewerkschaftsverband der stalinoiden Kommunistischen Partei (KKE), die den Dezember-Aufstand seinerzeit als Werk ausländischer Aufrührer denunzierte, besetzt plötzlich öffentliche Gebäude und Fernsehsender. Gleichzeitig schlägt sich die Hegemonie von KKE und regierungsnahen Gewerkschaften darin nieder, dass Streiks zeitlich begrenzt bleiben und die Antwort auf die Verarmungspolitik des Staates insgesamt viel zu schwach ausfällt. Die KKE wittert in den Protesten eine günstige Gelegenheit, ihren nationalistischen Anti-EU-Kurs zu propagieren, während SYRIZA, eine Art griechische Linkspartei, europäische Staatsanleihen und „gerechtere“ Krisenbewältigung fordert.
Kurz, die Gewerkschaften und die etatistische Linke in Griechenland sind so unbrauchbar wie überall, doch wie überall gilt, dass sie nicht als äußerlicher Hemmschuh der Klassenkämpfe denunziert werden können, sondern deren wirkliche Grenzen ausdrücken. Es sind von der griechischen Arbeiterinnenklasse keine Wunder zu erwarten; die Bedeutung der Zusammenstöße in Griechenland liegt darin, dass sie überhaupt den Klassengehalt der Krisenbewältigung offen legen, ihr Steine in den Weg rollen und das Chaos auf den Finanzmärkten und im Staatengefüge verschärfen.
... weit mehr als Griechenland
Bei dem medial inszenierten Spektakel, das sich gegen „die Betrüger“, „die Trickser vom Mittelmeer“ (Focus) richtet, geht es um weit mehr als Griechenland. Vorsorglich soll über alle Klassenschranken hinweg das verantwortungsvolle staatsbürgerliche Subjekt mobilisiert werden, das sich widerspruchslos in die Maschinerie von Kapital und Staat einpasst. Ein schöneres Gegenbild zum deutschen Steuerzahler als das von den faulen Griechen und ihrem morschen Staat hätte sich auch die PR-Abteilung der Bundesregierung kaum ausdenken können.
Im Sinne effektiven Krisenmanagements hat sich das korporatistische Modell der deutschen Sozialpartnerschaft, entgegen der landläufigen Meinung von dessen Ableben, das die Kritikerinnen des sogenannten Neoliberalismus glauben beweinen zu müssen, bislang noch einmal vollkommen bewährt. Zu keinem Zeitpunkt hatte es eine andere Funktion, als die institutionalisierte Arbeiterbewegung in Gestalt der Gewerkschaften produktiv zu integrieren, um den Laden aufrechtzuerhalten. Als Co-Moderatorinnen der Krisenbewältigung haben die Gewerkschaften bisher ihre Funktion pflichtgemäß erfüllt. So schwadronierte IG-Metall-Chef Huber, sich den Kopf des Kapitals zerbrechend, dass die Branche „über die Krise hinweg müsse“. Er verbrämte den jämmerlichen Abschluss der letzten Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, in welche die Gewerkschaften erstmalig ohne jegliche Lohnforderungen traten, als „faire Lastenverteilung“. Gesamtmetall-Chef Kannegießer weiß solches Engagement zu schätzen und sprach seinerseits von einem eindrucksvollen „Zeichen gemeinsamen Krisenmanagements“.
Damit setzt sich fort, was Deutschland in den letzten Jahren ein Exportwunder bescherte und zugleich einer der Gründe für die „griechische Tragödie“ ist. Durch die Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften und die Flexibilisierung der Arbeit konnte Deutschland seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen europäischen Staaten deutlich voran bringen; so sind Länder wie Griechenland unter verstärkten Druck geraten, während hierzulande von Krisenauswirkungen noch verhältnismäßig wenig zu spüren ist. Von vornherein ging es bei der Schaffung eines einheitlichen europäischen Währungsraumes darum, durch die Verlagerung der Geldpolitik auf eine supranationale Ebene wirtschaftlich schwächeren Staaten die Möglichkeit zu nehmen, durch eine Abwertung ihrer Währung die Position ihres nationalen Kapitals auf dem Weltmarkt zu verbessern. Statt dessen sollten die Staaten gezwungen werden, sich durch verschärfte Ausbeutung dem Produktivitäts-niveau ökonomisch stärkerer Staaten anzugleichen. Dabei war immer klar, dass dies in Ländern wie Griechenland nicht ohne einen radikalen Angriff auf die direkten wie indirekten Löhne möglich ist. Dieser Angriff wird nun in Griechenland mustergültig vorexerziert, und die Wirtschaftspresse spricht unverblümt aus, dass auch in Italien, Spanien, Portugal harte Einschnitte anstehen. Eben deshalb richten die Herrschenden Europas ihren Blick gebannt auf Athen: Wie weit kann man gehen, bis es knallt?
... über nationale Schranken hinweg
Für Deutschland scheint diese Frage weit hergeholt. Doch nicht von ungefähr sind neben den „Pleite-Griechen“ auch die einheimischen Arbeitslosen wieder ins Visier geraten. Im Staatshaushalt für 2010 ist eine Neuverschuldung von 80 Milliarden Euro vorgesehen. Hinzu kommen weitere 80 Milliarden für die beiden Konjunkturpakete und gleichzeitig verliert der Fiskus 8,5 Milliarden qua Steuerreform. Der Staat muss diese Verschuldung abbauen. Noch liegen die konkreten Pläne in der Schublade, aber das ganze ideologische Geplärre von „spätrömischer Dekadenz“ seitens Westerwelle und Konsorten lässt erahnen, wohin die Reise gehen soll. Als Kombi-Packung wird die Hetze gegen griechisches „Parasitentum“ und die „Trägheit“ von Hartz-IV-Beziehern von der Charaktermaske Thilo Sarrazin (SPD), seines Zeichens Vorstandsmitglied der Bundesbank, feilgeboten. Er empfiehlt Griechenland den Gang in die Insolvenz und Arbeitslosen einen dicken Pullover, um die Heizkosten zu senken.
Tatsächlich besteht die Ironie der jüngeren Arbeitsmarktreformen darin, dass sich Arbeit, wie Westerwelle ganz richtig bemerkt hat, für immer mehr Leute nicht mehr lohnt. Schon 2008 waren 1,4 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter auf ergänzendes Arbeitslosengeld II angewiesen – Tendenz steigend. Der Hamburger Langzeitarbeitslose Arno Dübel wurde kürzlich als asoziale Hassfigur durch die deutschen Talkshows gereicht, weil er diese schlichte Wahrheit ausgesprochen hatte: Das Leben von ALG II ist alles andere als üppig, aber besser als stupide Schufterei, bei der am Ende auch nicht mehr herauskommt, ist es allemal. Damit hat der bekennende Arbeitsverweigerer Dübel die Krux benannt, die hinter der aufgeregten Sozialstaatsdebatte steckt: die Arbeitsverhältnisse wurden so erfolgreich umgepflügt – es genügt ein Blick auf die mittlerweile rund 675.000 Menschen, die von Leiharbeit leben und zwischen 30 und 50 Prozent weniger verdienen als die Fest-angestellten –, dass selbst das magere ALG II als Alternative erscheinen kann. Da eine Anhebung der Niedriglöhne nicht in Frage kommt, bleiben nur weitere Schikanen auf den Ämtern; erst im April wurde beschlossen, künftig die Daumenschrauben bei jungen Arbeitslosen anzuziehen.
Entgegen aller anders lautenden Beteuerungen ist die Krise noch längst nicht zu Ende. Die Lage der Lohnabhängigen wird sich weiter verschärfen, nicht verbessern, denn Staat und Kapital stehen unter immensem Druck. In Griechenland hilft nur noch eine Radikalkur, in Deutschland dürfte es auf einen zähen Stellungskrieg hinauslaufen. Die links-reformerische Verteidigung des Sozialstaates, die das heilige Kriterium der Finanzierbarkeit überhaupt nicht in Frage stellt, erweist sich in dieser Situation als genauso untauglich wie ein verbalradikaler Maximalismus, der sich völlig abgekoppelt vom Alltagsleben als reine Aufklärungsbewegung in Demonstrationen „für den Kommunismus“ ergeht. Nicht die Verteidigung des Sozialstaates oder leere Worthülsen, sondern Kämpfe für unsere Interessen und Ansprüche legen der Krisenbewältigung Steine in den Weg. Sofern sie auf ökonomische Gesetzmäßigkeiten pfeifen, die Sorge um Staatshaushalt und Standortsicherung lässig zurückweisen und entsprechend rigide geführt werden, verweisen sie im Kleinen schon auf die Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft.
Nur solche Kämpfe eröffnen überhaupt die Chance, eine Klassensolidarität über nationale Schranken hinweg endlich praktisch werden zu lassen. So könnte eine internationale Situation entstehen, in der sich die Aufhebung der herrschenden Produktionsweise als praktisches Erfordernis geltend macht, der Kampf für Forderungen umschlägt in eine Bewegung der Besetzungen und direkten Aneignung.
Kosmoprolet, Mai 2010
Eiszeit (Zürich)
k-21 (Frankfurt/Main)
La Banda Vaga (Freiburg)
Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft (Berlin)
www.kosmoprolet.net · www.eis-zeit.net · www.labandavaga.org · www.klassenlos.tk
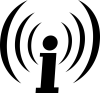

Diktatur der Gläubiger
Danke für euren Beitrag.
Im Abschnitt "Damit setzt sich fort, was Deutschland in den letzten Jahren ein Exportwunder bescherte und zugleich einer der Gründe für die „griechische Tragödie“ ist.(...)" ist eigentlich der Kern der Krise erklärt. Aber dieser wichtige Aspekt bliebt doch etwas unterbeleuchtet in eurem Text.
Den besten Beitrag, den ich bislang zur Griechenlandkrise gelesen haben ist "Diktatur der Gläubiger" von Gregor Kritidis. Er bringt die Situation genau auf den Punkt. Der Artikel erschien unter anderem auch in der März AK.
Zur Krise an sich haben die
Zur Krise an sich haben die Kosmoproleten in der Ausgabe 2 was verfasst.
http://klassenlos.tk/thesen_zur_krise.php