Auf zu einer antikapitalistischen Kampagne im Frühjahr 2010
„Eine Gesellschaft, in der die bewaffnete Staatsmacht dafür sorgt, dass ein Haus seinen menschlichen Zweck nicht erfüllt, ist offenkundig verrückt, und sobald die Proletarisierten im Bild des Polizisten das Wesen der Gesellschaft erkennen, könnte die Geschichte eine unerwartete Wendung nehmen.“ (kosmoprolet)
In der Krise spricht nicht mehr gegen den Kapitalismus als sonst. Die Bilder einer Lebenswelt staatlich garantierter Sicherheiten, in der das Glück der Menschen in einem schlechten Job, einem Auto und einem Reihenhaus mit Grillparty-Garten besteht, dürften einer Linken nicht weniger die Kotze hochkommen lassen, als der Blick auf die aktuellen Entwicklungen der kapitalistischen Welt.
In einer Phase, in der sich auch die Lebensbedingungen vieler Menschen im Einzugsbereich der deutschen und europäischen Linken schlagartig verschlechtern, gibt es allerdings kein Grund zur Bescheidenheit, denn gleichzeitig wachsen die technologischen Möglichkeiten der Abschaffung von Mangel, Hunger, Krankheit, Armut und Langeweile stetig. Die unbeholfenen Staatsappelle der Sozialstaatsnostalgiker_innen und die fast schon hilflos anmutenden Rettungsaktionen der Regierungen verdeutlichen: Die Utopie einer befreiten Gesellschaft, in der der materielle gesellschaftliche Reichtum tatsächlich allen Menschen zur Verfügung steht, ist das einzige realisierbare „Rettungspaket“, das seinen Namen verdient. Die Krise wird viele Menschen in existenzielle Not stürzen. Ihnen könnte daher der Widerspruch von Möglichkeit und Wirklichkeit unmittelbar einleuchten. Da allerdings selbst eine gerechtere Produktion und Verteilung von Gütern noch keine Emanzipation mit sich bringt, muss eine radikale Linke die genannten Widersprüche nicht nur theoretisch kritisieren, sondern auch die politische Praxis und selbstbestimmte und basisdemokratische Organisierung als Mittel ihrer Kritik verstehen. Dabei darf sie nicht vergessen, dass eine Kritik am Kapitalismus immer die Kritik an Herrschaft beinhalten muss. – Sexismus, Rassismus und Antisemitismus sind zwar historisch untrennbar mit kapitalistischen Herrschaftsverhältnissen verwoben, jedoch auch nach der Abschaffung des Kapitalismus weiter denkbar.
Die Retter in der Not: Sloterdijk und Lafontaine
Die Krise schreit nach Lösungen. Schuldige waren schnell gefunden. Experten_innen, Politiker_innen, Gewerkschaften und Reaktionäre_innen aller Couleur bewiesen dabei ihre „Kompetenz“. Es waren die Spekulanten_innen, denen die Krisenschuld zugeschrieben wurde. Mit der Unterscheidung in „raffendes“ und „produktives“ Kapital wurde einmal mehr ein antisemitisches Klischee bedient. Bei der Frage nach Zukunftsvorstellungen, die begründete Hoffnung auf Zustimmung hegen, geht es nicht weniger hoch her: Migranten_innen sollen keinen Anspruch auf staatliche Zuwendungen und Arbeitsplätze haben, Frauen sollen gefälligst zahlreich Kinder bekommen und gleichzeitig in Strukturen arbeiten, die sich mit der Doppelrolle als Mutter und Beschäftigte nur schlecht vertragen, – selbstverständlich zu geringeren Löhnen, als Ihre männlichen Altersgenossen, von Bildung ferngehaltene Menschen werden von vornherein in die Rolle der Almosenempfänger_innen gepresst. Die ganze alte Scheiße. Hier mit von der Partie: Peter Sloterdijk, ein wahrhaft deutscher Philosoph, der samt Anhänger_innenschaft dafür plädiert, Sozialleistungen künftig zur freiwilligen Sache der Reichen zu machen und sie damit einer noch größeren Willkür zu unterwerfen.
Auf der anderen Seite steht eine im Wesentlichen reformistische Linke, die sich – bemerkenswert monoton – über zu wenig Gerechtigkeit und Menschlichkeit beklagt. Bei aller berechtigten Kritik bleibt jedoch im Dunkeln, was eigentlich zur Diskussion steht, wenn tagtäglich von „Zukunftsmodellen“ und der großen Veränderung hin zu mehr „Verantwortung“ die Rede ist. Bei aller Einsicht, die der Schock der Krise bei einigen hergestellt haben mag, bleibt die Kritik erstaunlich ratlos: Man möge bitte Managerboni kürzen, Ludwig Erhardt lesen und einen Mindestlohn von 5,27 Euro inklusive Mehrwertsteuer einführen, weil sonst Ungerechtigkeit verschärft und die gesellschaftspolitischen Ordnungsmodelle am Ende seien. In ihrer Staatsfixiertheit geraten sowohl Sozialdemokraten_innen in und außerhalb der Parlamente, als auch die Gewerkschaften in Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber der schwarz-gelben Regierung.
Dabei offenbart die Dynamik der Krise vor allen Dingen eines: Der Kapitalismus befindet sich in einer historischen Situation, in der er selbst in seinen Zentren in zunehmenden Maße das Gegenteil seiner materiellen Möglichkeiten produziert. Mehr Maschinen, Lebensmittel, Technik und Wissen führen unter seinem Regiment zu immer noch mehr Armut, sozialer Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Konkurrenz. Dieser offenkundige Widerspruch bildet die scheinbar unhinterfragbare Diskussionsgrundlage, auf der von CDU über Gewerkschaften bis zur Linkspartei fast alle ihre unterschiedlichen sozialstaatlichen und vor allem sozialpartnerschaftlichen Ordnungsvorstellungen zur Wahl stellen.
Vor wenigen Jahrzehnten erschien der Kapitalismus noch in einem anderen Licht: der materielle Reichtum der privaten Haushalte hielt mit dem Wachstum der nationalen Wirtschaftsleistung ungefähr schritt, auch wenn die Hoffnung auf ein Stück vom Kuchen im Kapitalismus schon immer bloß als nationales Versprechen realistisch war und individuelle Opferbereitschaft verlangte. Allerdings warf der Kapitalismus für viele Menschen hier einen Teil des Profits ab, den er in anderen Teilen der Welt brutal und ganz und gar nicht „sozial“ einfuhr.
Die Lücke, die zwischen dem möglichen materiellen Reichtum und seiner
realen Struktur und Verteilung klaffte, war sicherlich schon damals
unübersehbar; jedoch konnten die kreditwürdigen Staatskassen und die
niedrige Arbeitslosigkeit diese Irrationalität zumindest in den
wirtschaftlich führenden Ländern teilweise überspielen. Mit der latenten
Krise des Kapitalismus der letzten Jahrzehnte, die zum großen „Crash“
führte und sich gerade an allen Ecken und Enden der Gesellschaft
manifestiert, offenbart sich nun ein anderes Bild. Mehr leere Wohnungen
und mehr Obdachlose: So ließe sich wohl in Kurzform die aktuelle
gesellschaftliche Entwicklung sinnbildlich zusammenfassen. Dass viele
Linke sich dadurch allerdings zum Abfeiern des Sozialstaates aufgerufen
fühlen, ist bedenklich. Sie kann der Absurdität der Entwicklung
kapitalistischer Gesellschaften nicht mehr als den Staat entgegenhalten,
der jedoch selbst in seiner fortschrittlichsten Gestalt nicht den
gesellschaftlichen Reichtum, sondern bloß die Staatskasse verwaltet und
darüber hinaus als Staat des Kapitals etwas ganz anderes im Sinne hat
und haben muss, als die Menschen vom Übel des Kapitalismus zu befreien.
Falsch verbunden: Die Linke und der Staat
Die Linke blamiert sich, wenn sie immer noch glaubt, der „starke Staat“ könne der Lage mit einer anderen Politik Herr werden. Sie erkennt die Finanzierbarkeit von Forderungen als Grundlage jedes politischen Diskurses an. Gerade in Zeiten immer schneller wachsender Staatsverschuldungen und erster Staatsbankrotte gilt es jedoch zu betonen, dass von allem genug da ist; dass eben gerade nicht die Finanzierbarkeit, sondern die schlichte Machbarkeit der Maßstab jeder vernünftigen Kritik sein muss.
Der nostalgischen Vorstellung der reformistischen Linken vom Sozialstaat sollte eine antikapitalistische Linke daher unbedingt ihren mehrfachen Irrtum vorhalten: Weder schafft dieser die grundsätzlichen Verhängnisse kapitalistischer Vergesellschaftung ab, noch tragen Sozialstaatsforderungen der Tatsache Rechnung, dass der Staat und seine „Sozialpolitik“ eben gerade nicht souverän, sondern systematisch abhängig von den Entwicklungen des Weltmarktes waren und sind.
Der „Sozialen Marktwirtschaft“ liegt immer die nationale Konjunktur zu Grunde, die wiederum abhängig ist von der Stellung im Weltmarktgefüge und nicht zuletzt von der ökonomischen und politischen Unterdrückung und Ausbeutung ganzer Kontinente, Teile der eigenen Bevölkerung eingeschlossen. Der Sozialstaat als Organ nationaler Umverteilung in der „Sozialen Marktwirtschaft“ ist daher nicht einmal im Rahmen seiner eigenen Finanzierbarkeit sozial. Das Geld, welches verteilt werden soll, muss der Steuerstaat schließlich auch haben. Über die Grenzen seiner Politik entscheidet daher nicht das Staatspersonal, sondern die Wirtschaftslage und der nationale Reichtum. Hinzu kommt, dass von seinen Vorzügen, zum Beispiel dem Recht auf Sozialleistungen, nur diejenigen profitieren, die als Bürger_innen dazu auserkoren sind. Das Einstimmen großer Teile der Linken in „Standort Deutschland“-Politik ist daher nur logisch: Sie wissen nur zu gut, dass ihr Sozialstaat ein Exklusivmodell für einen Weltmarktgewinner ist.
Wenn Berthold Huber, der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Metall, erklärt, man wolle sich künftig nicht auf Lohnforderungen, sondern auf den Erhalt von Arbeitsplätzen konzentrieren, hat diese gewerkschaftliche Bankrotterklärung einen wahren Kern. Sowohl Betriebe als auch die gesamte Gesellschaft inklusive des Staates sind im Kapitalismus darauf angewiesen, dass der Laden läuft, damit Löhne in den Betrieben oder Almosen des Staates verteilt werden können. Die Krise kapitalistischer Akkumulation bedeutet so immer auch die Krise aller Menschen, die vom Marktgeschehen abhängig sind. Aus dieser Perspektive scheinen die Auseinandersetzungen zwischen Freunden und Feinden des Sozialstaates weniger grundsätzlich. Die aktuelle Auseinandersetzung zwischen sogenannten Neoliberalen und Sozialstaatsnostalgiker_innen entpuppt sich insofern als Streit darüber, mit welcher politischen Strategie eine stabile Position in der verschärften Weltmarktkonkurrenz durchgesetzt werden kann.
Wie staatliche Politik gestaltet und die Staatskasse verwaltet wird, darüber entscheiden jedoch auch die sozialen Kämpfe und Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb des Staates. Die permanente Orientierung staatlicher Politik an Kapitalinteressen ist die Grundlage dieser Kämpfe. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass diese Kämpfe etwas am Ablauf des großen Ganzen ändern würden, selbst wenn sie „erfolgreich“ sind. Denn für gewöhnlich stellen auch diese Kämpfe nicht die derzeitige Organisation der Gesellschaft als solche in Frage, sondern bloß die „ungerechte “, „unsoziale“ usw. Verteilung der Staatskasse. Damit steht ein Großteil der Kämpfe der Verwirklichung derjenigen gesamtgesellschaftlichen Ziele, die auf mehr hinaus wollen als die finanzielle Besserstellung einer gesellschaftlichen Gruppe, im Weg. Ohne die Bereitschaft, das Übel des Kapitalismus an seiner Wurzel zu packen, besiegelt etwa die Forderung nach mehr (Lohn-) Gerechtigkeit die gesellschaftliche Konkurrenz untereinander und die ganz und gar nicht gemeinschaftliche Verfassung kapitalistischer Wirtschaft. Außerdem entscheidet sich hier, wer als Bürger_in überhaupt Ansprüche an die nationalstaatliche Gemeinschaft stellen darf. Denn dafür sind stets (rassistische, sozialdarwinistische oder nationalistische) Ausschlusskriterien nötig.
Eine linke Kritik sollte daher nicht bloß auf die staatliche Umverteilung zielen, sondern vielmehr auf die Tatsache, dass die kapitalistische Art gesellschaftlicher Planung eine Produktion ohne Zwang zur Profitmaximierung und eine gerechte Verteilung von Gütern unmöglich macht. Nicht die Staatskasse, sondern der vorhandene materielle Reichtum der Gesellschaft muss der Maßstab einer vernünftigen linken Kritik sein.
Happiness: Just around the corner
Die aktuelle Wirtschaftskrise ist nicht nur das Resultat einer im Ganzen irrationalen Produktionsweise, sie macht den schon immer im Kapitalismus bestehenden Widerspruch von Möglichkeit und Wirklichkeit auf eine mehr als zynische Weise erfahrbar. Das Potential einer Welt, die beinahe alle notwendigen Güter im Überfluss produzieren kann und die eine radikale Verringerung der notwendigen Arbeitszeit eines jeden Menschen möglich gemacht hat, verkehrt sich unter Bedingungen kapitalistischer Produktion in das reale Unglück von Arbeitslosigkeit, Pleiten und (zunehmender) Konkurrenz. Statt einer vernünftigen Nutzung technischer und natürlicher Ressourcen und einer an Bedürfnissen orientierten Produktion und Verteilung bedeutet die aktuelle Dynamik des Kapitalismus den Ausschluss von immer mehr Menschen von diesem Reichtum.
An jeder Entlassung, an hunderten „Schwarzfahrern_innen“ in deutschen
Gefängnissen, an jedem leeren Wohnhaus und am weltweiten Elend zeigt
sich nicht das persönliche Versagen, Unter- oder Überqualifikation,
Disziplinlosigkeit und dergleichen, sondern die Überkommenheit des
Kapitalismus. Das wortwörtliche Schicksal der Menschen besteht in der
Abhängigkeit ihres eigenen Wohls von unplanbaren wirtschaftlichen
Entwicklungen und dem damit drohenden oder realen Mangel an Mitteln zur
gesellschaftlichen Teilhabe. Jedes private materielle Elend ist vor dem
Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen Reichtums absurd.
Politikverdrossenheit, Ohnmachtsbekundungen und Nichtwähler_innentum
sind möglicherweise der hoffnungs- und perspektivlose Ausdruck einer
solchen Entwicklung. Genau hier kann eine antikapitalistische Kritik
ihren praktischen Ausdruck finden.
3… 2… 1… unsers?
Einer radikalen Linken kann und sollte es nicht darum gehen, sozialen Konflikten mit dem Verweis auf ihre Begrenztheit den Rücken zu kehren. Vielmehr sollten wir uns darum bemühen, die Gründe solcher Grenzen zu benennen und eine inhaltliche und praktische Alternative zur Bittstellerei an den Staat anbieten. Die Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten und Perspektiven sollte dabei nicht unterschätzt werden. Wenn soziale Auseinandersetzungen um die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums anstehen, müssen wir die Beschränktheit der jeweils für sich genommenen berechtigten Forderungen nach Verbesserungen der Lebensverhältnisse verdeutlichen, wenn wir uns an diesen Kämpfen mit einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive beteiligen.
Ein antikapitalistisches Rettungspaket müsste vor allen Dingen eines ins Visier nehmen: Die Produktionsweise und die Verteilung ihrer Güter selbst. Dabei muss die Nutzbarmachung des gesellschaftlichen Reichtums für selbstbestimmte Zwecke eingefordert und zur Selbstermächtigung ermutigt werden. Allerdings sollte eine antikapitalistische Linke darauf beharren, dass Umverteilung (mutet sie noch so fortschrittlich und antistaatlich an) noch längst nicht das Ende allen Übels bedeutet. Letztendlich geht es um die gesellschaftliche Aneignung ganzer Prozesse, anstatt deren Produkte lediglich günstiger oder umsonst haben zu wollen. Wir wollen die Abschaffung der Lohnarbeit und nicht nur höhere Löhne. Statt einer lediglich kostenlosen Ausbildung wollen wir ein von Kapitalinteressen befreites Studium, eine entökonomisierte Forschung und eine Stadt, die nicht nur auf Konsum und Arbeit ausgerichtet ist, in der selbst der Fahrtakt der U-Bahn diese wirtschaftliche Interessen spiegelt.
Als antikapitalistische Linke organisieren wir zwar eine Menge Diskussionsveranstaltungen, Demonstrationen, Partys und Kampagnen. Vorschläge, wie eine sozialrevolutionäre Dynamik von sozialen Kämpfen aussehen könnte, sind allerdings selten. Die schlechte Alternative zu den staatstragenden Forderungen von Linkspartei und Gewerkschaften, ein verbalradikaler Antikapitalismus, der sich einer politischen Praxis entledigt hat, kann nicht einfach hingenommen werden. Die Praxis kollektiver Aneignung bietet die Chance, Ansätze eines anderen Verständnisses von Gesellschaft aufzuzeigen. Gemeinsames Schwarzfahren, öffentliche Umverteilungsaktionen, politische und ökonomische Streiks, die Verhinderung von Kontrollen und Vorladungen auf Ämter und Behörden, die Besetzung von Unis, Wohn- und Kulturräumen sind nur einige Aktionsformen einer langen Liste von Möglichkeiten, soziale Kämpfe zu führen.
Die Widersprüche einer solchen Praxis sind vorprogrammiert. Nischen, vermeintliche Freiräume, Kommunen und selbstorganisierte Betriebe stehen genauso wenig außerhalb gesellschaftlicher Zwänge wie die Forderung nach kostenloser Mobilität. Schon oft mündeten linke Ausstiegsversuche im vermeintlich privaten Glück oder in der (keinesfalls mit emanzipatorischer Autonomie zu verwechselnden) kollektiven Organisierung kapitalistischer Betriebe. Solange der Kapitalismus als Ganzes nicht massenhaft angegriffen wird, ist es daher bei der Einmischung in und der Beteiligung an aufflammenden sozialen Kämpfen weniger zentral, worum es im Einzelnen geht. Vielmehr können in der Art, wie gekämpft wird, Elemente der zukünftigen Gesellschaft wie Kollektivität, Solidarität, Verbindlichkeit, Entfaltungsmöglichkeiten der Einzelnen und basisdemokratische Entscheidungsstrukturen vermittelt werden.
Die Beteiligung an diesen Kämpfen kann dann zu einem Bewusstsein führen, dass nur die Abschaffung des Kapitalismus die Widersprüche sozialer Kämpfe wirklich wird lösen können.
Wir haben schließlich nicht nur eine Welt zu gewinnen, sondern auch immer weniger zu verlieren.
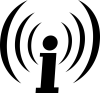

3 2 1 keins!
Letztendlich geht es um die gesellschaftliche Aneignung ganzer Prozesse - was für ein Unfug. Es müßte doch wohl heißen: Letztendlich geht es um die Aneignung ganzer (?) gesellschaftlicher Prozesse.
Der Begriff der "Gesellschaft" ist von seinen Wesen her ein Begriff der kapitalistischen Produktionsweise. "Gesellschaft" ist ein ökonomischer Terminus zum Ausdruck komplexer arbeitsgeteilter Produktionsprozesse. Marx selbst hat diesen Begriff so verwendet, ihn aber immer wieder auch zur Beschreibung ökonomischer Zusammenhänge auf nationalstaatlichem Niveau gebraucht.
Die "Sozialisierung" des ökonomischen Begriffs der "Gesellschaft" ist heute allerdings unreflektiert Grundlage der Analyse des Bestehenden und Grundlage der Zielsetzung politischer Forderungen in der Linken.
Da verwundert mich dann doch die Kritik, die parlamentarische Linke wäre staatstragend. Die radikale Linke und ihr kategorischer Bezug auf die Gesellschaft (und sei sie "frei" - ein Widerspruch in sich) sind genau so nationall-strukturell orientiert und auf einem kapitalistischen Modell der Produktionsweise begründet. Ablehnung des Staates und des Kapitalismus bei gleichzeitig positiven Bezug auf "die Gesellschaft" offenbart nichts weiter als ein geringes Reflektionsniveau.
Ansonsten hat mir der Text gut gefallen, nur eben diese Kleinigkeit.