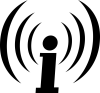Sie waren Zivilisten, völlig unpolitisch. Oder sie sind Deserteure. Nun kämpfen sie auf Seiten der Freien Syrischen Armee gemeinsam gegen Assads Regime. Es geht um jeden Posten und die Hoffnung, den Friedensplan nicht zu verlieren.
Bis vor vier Monaten ist Jumah al-Najaar aus der Nähe von Aleppo Steinmetz gewesen. „Als die Revolution begann, haben wir friedlich gegen Baschar al-Assad demonstriert. Doch sie haben auf uns geschossen.“ Er wolle sich nicht töten lassen, sagt der 24-Jährige. Deswegen ist er ein Kämpfer der Freien Syrischen Armee (FSA) geworden, die im vergangenen Sommer den bewaffneten Aufstand gegen das Regime von Assad in Syrien aufgenommen hat. Jumah al-Najaar hat eine Schusswunde in der rechten Schulter, die im Flüchtlingslager bei Kilis im Süden der Türkei behandelt wird. Er hat am vergangenen Montag gekämpft, in der Schlacht um den Zollposten im Dorf Bab al-Salam an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei.
Der Angriff begann um drei Uhr morgens. Die Rebellen hatten sich um das niedrige Zollgebäude gruppiert und eröffneten von drei Seiten gleichzeitig das Feuer. Einige warfen selbst gefertigte Handgranaten. Sie hatten das Überraschungsmoment auf ihrer Seite und rechneten nicht mit starker Gegenwehr. Doch die Feinde waren viele und gut munitioniert. Sie antworteten mit einem wahren Kugelhagel, erzählt Jumah al-Najaar.
Acht Stunden dauerte die Schlacht. Fünfmal, sagt er, habe seine Kompanie den Posten erobert – und ihn fünfmal wieder räumen müssen. „Ich hatte die Aufgabe, die getöteten Feinde zu zählen. Es waren 20. Wir hatten neun Verwundete.“ Zusammen mit anderen Syrern steht er in der Frühlingssonne vor dem mit Betonmauern, Sichtblenden und Stacheldraht gesicherten Flüchtlingslager nahe der Kleinstadt Kilis. 9 300 syrische Flüchtlinge sind in den vergangenen zwei Wochen aus weiter südlich gelegenen Zeltlagern hierher verlegt worden, wo die Türken mit 2 000 neuen Containern, mit Schulen, Küchen und Feldlazarett eine hochmoderne Notsiedlung für 12 000 Menschen aus dem Boden gestampft haben. Insgesamt haben rund 25 000 Syrer Zuflucht in der Türkei gesucht, derzeit kommen 500 bis 1 000 pro Tag. Ein gravierender Nachteil des Camps in Kilis ist jedoch seine Lage direkt neben dem Grenzposten.
Der 24-jährige Flüchtling Jumah al-Mustafa, gelernter Käsemacher aus dem syrischen Idlib, wachte am Montagmorgen von den Schüssen auf, das Gefecht war nur hundert- bis zweihundert Meter entfernt: „Am Mittag sahen wir, wie einige Kämpfer versuchten, über den Grenzzaun zu klettern. Sie wurden beschossen. Wir liefen zum Zaun, um ihnen zu helfen.“
Das Gelände ist an dieser Stelle relativ flach. Die syrischen Soldaten hatten freies Schussfeld. Sie feuerten nicht nur auf die Flüchtenden, sondern auch auf die herbeieilenden Helfer aus dem Lager. Die Kugeln verwundeten zwei FSA-Kämpfer, aber sie trafen auch fünf Menschen im türkischen Camp. Zwei völlig unbeteiligte Flüchtlinge starben. Jumah al-Mustafa kramt sein Handy aus der Tasche. Er spielt ein Video ab, man hört Schüsse, Schreie. Man sieht aufgeregte Männer, die auf Löcher in den Wohncontainern deuten. „Überall Einschüsse“, sagt er. Einige Kugeln hätten gleich mehrere Containerwände durchschlagen. Jumah al-Mustafa sagt: „Wir sind in die Türkei gekommen, um vor den Killern des Regimes sicher zu sein. Jetzt töten sie uns auch hier.“ Erstmals haben syrische Soldaten auf türkisches Gebiet geschossen. „Die Türken sind getroffen worden, aber sie haben nicht zurückgeschossen. Sie haben uns auch nicht schützen können“, sagt Jumah al-Mustafa. „Niemand hilft uns.“
Verletzter Stolz
Der junge Syrer hat kaum eine Vorstellung davon, wie schwer die Schüsse aus Syrien den türkischen Nationalstolz verletzt haben. Zwei Tage lang beherrschten die Nachrichten aus Kilis die Schlagzeilen, auf Facebook und Twitter beklagten viele die beschämende Untätigkeit der türkischen Armee. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, gerade auf Besuch in China, reagierte mit Drohungen gegen Damaskus. Die Türkei könne den Nato-Bündnisfall ausrufen, sagte er. Das würde Krieg bedeuten.
Noch hält die am Donnerstag eingetretene Waffenruhe, aber sie könnte schnell brüchig werden. „Wir werden sie befolgen“, sagt Jumah al-Najaar, der zum Rebellen gewordene Steinmetz. Aber er glaubt nicht, dass damit Frieden im Land einkehrt: „Es ist eine Waffenpause, mehr nicht. Das Regime wird niemals einlenken.“
Nicht nur den Türken, die ihm medizinische Hilfe leisten, auch seinen Landsleuten aus dem Flüchtlingslager ist Jumah al-Najaar unendlich dankbar. Sie hätten ihm und neun Kameraden unter Lebensgefahr über den Grenzzaun geholfen, als er von mehreren Kugeln getroffen wurde, erzählt er. Sie halfen auch seinem 20-jährigen Cousin Samir. Er bestach vor drei Monaten einen Offizier, um Urlaub zu bekommen und desertierte. Beide Männer gehören zu einer von zwei in Maraa stationierten FSA-Kompanien von je 55 Mann, berichten sie. Die Stadt sei praktisch leer, alle 40 000 Einwohner seien geflohen, die meisten zu Verwandten in die Zwei-Millionen-Metropole Aleppo. Während es in Aleppo selbst wegen der massiven Präsenz von Armee, Polizei und den gefürchteten Schabiha-Schlägern kaum zu Gefechten komme, sei das gesamte Umland bereits seit Monaten Kampfzone.
Die Brutalität nimmt täglich zu. Nicht nur die Kämpfer, auch zivile Flüchtlinge berichten über Gräueltaten der Regimetruppen, und über Massenvergewaltigungen, willkürliche Exekutionen, Messer- und Schwertattacken auf friedliche Demonstranten. Viele Flüchtlinge haben unter der Folter schwere Verletzungen davongetragen: ausgerissene Fußnägel, Schnittwunden an den Genitalien, tiefe Narben im Gesicht. „Am vergangenen Sonntag haben sie einen FSA-Kommandeur in Tel-Refat auf offener Straße mit Benzin übergossen und angezündet“, sagt Samir.
„Alawiten sind Teufel“
„Das Regime schürt den Hass“, sagt Jumah al-Nasaar. Er sei früher unpolitisch gewesen. Er habe keinem Menschen Böses gewünscht. „Aber Baschar al-Assad hat uns gelehrt zu hassen. Wenn wir jetzt einen Alawiten in unserem Gebiet antreffen, dann töten wir ihn.“ Das Assad-Regime stützt seine Gewaltherrschaft auf die muslimisch-schiitische Alawitensekte, deren Mitglieder die wesentlichen Positionen in Staat, Geschäft und Militär besetzen. „Alawiten sind Teufel“, sagt Jumah al-Najaar.
An rund 50 Operationen, erzählt al-Najaar, habe er teilgenommen − 20 Kameraden seien dabei gefallen. Meistens waren es Angriffe auf Militärfahrzeuge, auf Kontrollpunkte, oder es ging um die Eskortierung von Flüchtlingen zur Grenze. Die Einheiten kommunizieren mit Mobil-oder Satellitentelefonen und, wenn irgend möglich, über den Internet-Telefondienst Skype, der schwerer abgehört werden kann. Sie operieren meist nachts, um den Helikoptern und Panzern zu entgehen.
„Jede Kompanie handelt weitgehend selbstständig. Nur wenn eine größere Aktion stattfindet, kommt die Koordination vom lokalen FSA-Oberkommando in Aleppo“, sagt Jumah al-Nasaar. „Alles, was in Syrien geschieht, wird auch in Syrien geplant.“ Von dem sogenannten FSA-Oberkommandeur Riad al-Asaad im türkischen Exil nehme kein Kämpfer einen Befehl entgegen.
Um Waffen und Munition kaufen zu können, haben Jumah al-Nasaar und seine Kameraden ihre Autos und sogar den Schmuck der Frauen verkauft. „Deserteure bringen ihre Gewehre mit. Wenn wir einen Checkpoint angreifen, erbeuten wir Waffen. Aber meistens müssen wir alles kaufen.“ 3 000 US-Dollar koste inzwischen eine Kalaschnikow bei den syrisch-kurdischen Schmugglern, vier Dollar eine einzige Patrone. Jede Kompanie verfüge über höchstens eine Panzerabwehrbüchse, für eine Granate seien 500 Dollar fällig: „Wir sparen uns jeden Schuss vom Mund ab“, sagt er.
Die Rebellen kämpfen mit leichten Waffen gegen Maschinengewehre und Panzer, aber sie kämpfen mit dem Mut der Verzweiflung und zunehmend besserer Logistik. Praktisch die gesamte Zivilbevölkerung im Umland von Aleppo sei auf ihrer Seite, sagen sie, und versorge sie mit Essen, Medikamenten, Notunterkünften. Militärisch machten sie Fortschritte. Am Sonntag vor einer Woche hätten sie erstmals einen Armeehubschrauber abgeschossen. Am Wochenende davor fand die größte und bisher erfolgreichste Operation der Kämpfer aus Maraa statt. „Mit 400 Mann haben wir den Armeeflugplatz in Migin bei Aleppo attackiert“, sagt Jumah al-Nasaar. Der Angriff begann gegen Mitternacht, nach zwei Stunden hätten die Verteidiger kapituliert. „Viele Soldaten sind zu uns übergelaufen.“ Dann habe man per Megafon über den Abzug der Regimetruppen verhandelt – und die Kerosintanks und die Flugzeuge auf dem Rollfeld in Brand gesteckt.
Ziel des Angriff auf den syrischen Grenzposten in Bab al-Salam war es, die Straße ins türkische Kilis für Flüchtlinge freizukämpfen. „ Wenige Kilometer entfernt in Azaz hatte es ein Massaker gegeben.“, sagt al-Najaar. „Wir hatten aber in der letzten Zeit große Probleme, sie sicher in die Türkei zu bringen und brauchten diese Straße. Viele Felder sind inzwischen vermint.“ Ein Flüchtlingstreck von rund 60 Männern, Frauen und Kindern sollte in Bab el-Salam am Montagmittag hinüber geleitet werden.
Den Treck leitete ein Mann, den sie im Umland von Aleppo nur Abu Ibrahim, Vater Ibrahim, nennen. Die Flüchtlinge waren mit Traktoren unterwegs. Kurz bevor sie Bab al-Salam erreichten, gerieten sie unter Feuer. „Plötzlich erhielten wir die Nachricht, dass unser Oberkommandeur verwundet war“, erzählt Jumah al-Najaar. „Daraufhin beschlossen wir, uns vom Grenzposten zurückzuziehen und mit den Verwundeten in die Türkei zu fliehen.“
Journalisten sollen nicht ins Flüchtlingscamp
Sein Kommandeur liegt verwundet im Krankenhaus von Kilis. Es ist nicht einfach, mit Abu Ibrahim zu sprechen. Die türkische Polizei ist darauf bedacht, keine Journalisten ins Flüchtlingscamp oder Krankenhaus einzulassen. Mit Hilfe syrischer Flüchtlinge lässt sich aber ein Weg in das Krankenzimmer finden. Beide seiner Füße, das linke Knie und der Rücken sind bandagiert. „Ich wurde von fünf Kugeln getroffen, als sie den Treck angegriffen haben“, sagt der 42-Jährige. „Es waren Scharfschützen mit Schalldämpfergewehren. Schwarz gekleidet, wahrscheinlich libanesische Hisbollah-Söldner.“ Abu Ibrahim wäre an den Wunden fast verblutet.
Seit Herbst vergangenen Jahres führt er mit drei weiteren Männern das Kommando über die FSA-Division im Umland von Aleppo. Solche Komitees gibt es inzwischen überall in Syrien. Abu Ibrahim legt Wert darauf, dass sie ausschließlich aus Zivilisten bestünden, dass sie der FSA die Befehle erteilten und dass es Zivilisten seien, die zum Beispiel über gefangene Häscher des Regimes urteilen. „Es hat in schweren Fällen auch Exekutionen gegeben. Aber wir haben das eingestellt.“ Seinem Revolutionskomitee unterstünden derzeit 600 Kämpfer, sagt Abu Ibrahim. „Die einzelnen Kompanien agieren weitgehend selbstständig. Aber größere Operationen plant unser Revolutionskomitee – denn nur wir haben den Überblick und die landesweiten Kontakte.“ Deshalb sei er sich auch sicher, dass die verheerenden Bombenanschläge von Aleppo und Damaskus nicht von der FSA verübt wurden.
Der Hass wächst
Abu Ibrahim ist ein erfahrener Mann der Opposition, er wurde dreimal eingesperrt und gefoltert, zuletzt 2008. „Wir sind keine Dummköpfe“, sagt er. „Wir kennen die geopolitische Lage Syriens. Aber wir wollen Freiheit und Demokratie wie in Europa und bitten die Weltgemeinschaft, das syrische Volk nicht länger im Stich zu lassen.“ Zwar hätten die Revolutionskomitees jetzt beschlossen, die Waffenruhe einzuhalten. Doch die Voraussetzung für jeden echten Friedensplan sei der Rücktritt von Baschar al-Assad. Dessen Vorwürfe, die Opposition sei vom Ausland finanziert, bezeichnet er als himmelschreiende Lüge.
„Das Geld, das wir haben, geben uns die Geschäftsleute aus Aleppo“, sagt Abu Ibrahim. Und zwar nicht nur die Sunniten, sondern auch Christen, Drusen, Kurden. „Sie alle unterstützen uns, auch wenn sie die Unterstützung nicht offen zeigen können. Nur die Alawiten nicht, sie schüren den Hass.“ Und der Hass wächst.