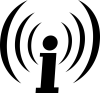Diskussion Es wird Zeit, dass die Antifabewegung das Thema NSU nicht mehr der Zivilgesellschaft überlässt
Von Maike Zimmermann
Vor fast einem Jahr, am 4. November 2011, wurde die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) bekannt. Seitdem reißen die Meldungen über Versagen und Ungereimheiten bei den Behörden für Verfassungsschutz nicht ab. Man könnte meinen, dass es vor allem die antifaschistische Bewegung ist, die den vielschichtigen Skandal um den NSU thematisiert. Doch jene Bewegung wurde vom Eintreffen der eigenen Vorhersagen nicht nur böse überrascht (siehe ak 573), sie hält sich seitdem politisch weitgehend zurück - wenn man von den sehr aktiven antifaschistischen Publikationen und Recherchenetzwerken absieht.
Warum lässt sich die »autonome Antifa« solch ein ureigenes Thema - Neonazismus - aus der Hand nehmen? Bei den meisten Antifaaktionen des vergangenen Jahres findet sich wenig mehr als ein Standardsatz zum Thema NSU. Versuche, das Thema aktiv in den Mittelpunkt der eigenen Politik zu rücken, gibt es kaum.
Die Netzwerke, auf die der NSU zurückgreifen konnte, entstanden ab Mitte der 1990er Jahre aus einer überregional organisierten und hoch aktiven Neonaziszene. (Siehe ak 574) Hierbei handelt es sich um Strukturen, die noch immer existieren. Auf diese Kontinuitäten hinzuweisen, ist eigentlich ein Terrain, auf dem sich antifaschistische Politik bestens auskennt. Immerhin: Im September gab es eine Demonstration am Wohnort des jahrzehntelang aktiven Nazikaders Arnulf Priem. »Rostock war die Initialzündnung für eine rechte Gewaltwelle, die die gesamten 1990er Jahre andauerte«, schreiben die North East Antifaschists (NEA) und ziehen eine Verbindung zwischen Pogromen, Straßenterror und Entstehung des NSU.
»Nazis aus der Deckung holen« heißt es in ihrem Aufruf - das gilt nicht nur Arnulf Priem. Nach dem Tod Michael Kühnens leitete er zusammen mit Gottfried Küssel und Christian Worch die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front (GdNF), die unter anderem mit dem »Generalplan Ost« den Aufbau von Organisationsstrukturen in der ehemaligen DDR vorantrieb. Beide Neonazis sind nach wie vor aktiv - Worch gründete unlängst die Partei Die Rechte, Küssel muss sich aktuell in Wien vor Gericht wegen »Wiederbetätigung und Verhetzung« verantworten. Und es gibt noch viele weitere Neonazis, die großen Anteil an der Entstehung neonazistischer Kernmilieus (siehe ak 567) hatten.
Vor zwölf Jahren kamen die Anständigen
Nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Düsseldorf rief der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder im Oktober 2000 den »Aufstand der Anständigen« aus. In der Folge entstanden unter anderem die Bundesprogramme zur Unterstützung von Initiativen gegen Rechts. Schon kurz zuvor wurde das Musiknetzwerk Blood & Honour verboten - eine Struktur, die faktisch bis heute besteht und eng mit dem Umfeld des NSU verknüpft war. Wenn der Staat nun also die repressive Schraube gegen Neonazis anzieht - sei es beim Aktionsbüro Mittelrhein, dem Nationalen Widerstand Dortmund oder der Nazigruppierung Besseres Hannover - kann dies keineswegs ein Grund zur Entwarnung sein.
In diese »anständige« Zeit fällt auch das erste (und gescheiterte) NPD-Verbotsverfahren. Die Diskussion wird seit einem Jahr wieder verstärkt geführt. Schon bei der ersten Runde im Jahr 2001 tat sich die Antifabewegung mit einer solchen »bürgerlichen Forderung« schwer - ohne wirklich mit Argumenten aufwarten zu können. Parteien, Verbote, Verfahren, Institutionen - das alles ist den Autonomen grundlegend suspekt. Gleichzeitig zeigte sich die autonome antifaschistische Bewegung schon damals in einem desolaten Zustand: »Ihre momentane politische Schwäche wurde ausgerechnet im Antifa-Sommer 2000 offenkundig, als die bürgerliche Öffentlichkeit endlich der Gefahr von rechts genügend Aufmerksamkeit widmete und die linksradikalen, antifaschistischen Kräfte sich als unfähig erwiesen, das unverhoffte Medieninteresse für eigene politische Akzente zu nutzen.« (ak 449) Ein Satz aus dem Jahr 2001, der heute wieder aktuell erscheint.
Gerade bei den sich selbst als autonome Antifas bezeichnenden Teilen der Bewegung speist sich die eigene Identität nicht unwesentlich aus Abgrenzung. Und wenn alle wie im »Antifasommer« plötzlich Nazis schlimm finden oder eben eine Forderung wie die nach Abschaffung des Verfassungsschutzes bis weit ins bürgerliche Lager hineinreicht, bekommt man abgrenzungsmäßig ein Problem.
Dabei bieten sich eigentlich gute Ansatzpunkte nicht nur für antifaschistische Arbeit, sondern auch für eine radikale Kritik an diesem Staat. Doch scheint der Antifabewegung hier nicht zuletzt der mangelnde Bündniswille auf die Füße zu fallen. Dresden Nazifrei und andere breite Mobilisierungen haben es vorgemacht: Mit einer antifaschistischen Politik, die auf Offenheit und Nachhaltigkeit abzielt, lässt sich der Resonanzraum für explizit linke Forderungen deutlich erweitern. (1) Die radikale Linke lässt sich davon jedoch offenbar nur langsam überzeugen. Zu groß ist die Furcht vor Instrumentalisierung und vor Verwässerung linker Positionen - auch wenn oft nicht ganz klar wird, worin letztere eigentlich bestehen.
Und so überlässt die autonome Antifa das Feld mehr oder weniger der Zivilgesellschaft. Verzichtet wird auf die Möglichkeit, linke Positionen stark zu machen. Zwar wird Rassismus seit einem Jahr auch von Antifagruppen stärker thematisiert. Aber beispielsweise das Zugehen auf die Opfer rassistischer Gewalt fällt den meisten eher schwer. Dabei bietet gerade das Thema Rassismus die Chance auf eine deutliche Linksverschiebung - sei es in Bezug auf staatliche Flüchtlingspolitik oder der Thematisierung von Alltagsrassismen.
Die Antifa muss ihre Chance ergreifen
Rechter Terror wird von Staat und Gesellschaft hauptsächlich als Sicherheitsproblem angesehen. Die Abtrennung von Naziterroristen nicht nur von der rechten Szene, sondern auch vom Rest der Gesellschaft entbindet letztere von der Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle. Hier den Finger stärker in die Wunde zu legen, wäre eine wichtige Aufgabe für AntifaschistInnen.
Sicherlich, in einigen Städten gibt es durchaus Antifagruppen, die sich intensiv mit dem Thema NSU beschäftigen und versuchen, dies in ihrer Praxis sichtbar zu machen. Zum Jahrestag des Bekanntwerdens der Mordserie wird es in vielen Orten Demonstrationen geben. (Siehe Seite 1) Aber auch hier fällt auf: Federführend sind eher diejenigen, die sich in der Zivilgesellschaft verorten und weniger klassische Antifas.
Die antifaschistische Bewegung sollte es dringend vermeiden, in eine ähnliche Sprachlosigkeit und Handlungsunfähigkeit zu verfallen wie im sogenannten Antifasommer. Stattdessen ist es jetzt an der Zeit, über Stoßrichtung und Schwerpunktsetzung in der eigenen Politik zu diskutieren. Drei mögliche Ansatzpunkte drängen sich hier auf. 1. Auf dem Feld der »klassischen Antifaarbeit« lassen sich Kontinuitäten klarer herausarbeiten - dieses solide »Handwerk« müssten AntifaschistInnen eigentlich beherrschen. 2. Selten gab es eine solch ablehnende Stimmung gegenüber den Behörden für Verfassungsschutz. Das wird vermutlich nicht lange so bleiben. Die staatliche Sicherheitsarchitektur wird sich in naher Zukunft verändern - jetzt lässt sich in diesen Veränderungsprozess eingreifen, jetzt lassen sich dafür BündnispartnerInnen finden. 3. Bei aller Diskussion und Empörung über Neonazis und Verfassungsschutz droht das Thema Rassismus ins Hintertreffen zu geraten. Noch bietet die gesellschaftliche Stimmung auch hier Anknüpfungspunkte, wenn man jetzt nicht Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik auf die politische Agenda setzt, manifestiert die Antifa damit einmal mehr ihr eigene Unfähigkeit.
Anmerkung:
1) Das gilt zum Beispiel für die Abwehr der sogenannten Extremismusdoktrin. Kaum ein Argument wiegt schwerer als ein verlässlicher als »linksextremistisch« denunzierter Bündnispartner.