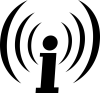Von Bar-Yuchnei
Wir haben folgenden Text der Gruppe endnotes ins Deutsche übersetzt, da wir denken, dass er wichtige Denkanstöße zur Diskussion über die globale Krise liefern kann. Den englischen Original-Text findet Ihr hier . Fußnoten und eine Tabelle über die Gesamtschulden in Prozent des BIP ausgewählte Länder von 2007-2011 findet Ihr entweder in den angehängten pdfs oder auf unserer Homepage.
Wie sollen wir die aktuelle Runde der Sparpolitik deuten? Sollen wir Keynesianern wie Paul Krugman glauben, wenn sie behaupten, dass die Kapitalisten mit der Forderung nach Einschnitten gegen ihre eigenen Interessen handeln? Sind die Staatsfinanzen wirklich unter Druck oder ist das alles nur ein Trick, um die letzten verbliebenen Errungenschaften aus den Arbeitskämpfen zu untergraben? Einige Mitglieder von Endnotes nehmen sich dieser Fragen an...
Eine Krise ist zuallererst eine Krise für die Arbeiter_innen. Aber sie ist eine Krise für die Arbeiter_innen, weil sie eine Krise des Kapitals ist. Dass es sich so verhält, ist nicht immer offensichtlich. Wann immer das BIP sinkt, rufen die Vertreter des Kapitals ausnahmslos nach "gemeinsamen Opfern" – also nach Opfern, die gemeinsam von den Lohnabhängigen erbracht werden sollen. Es wäre eine Sache, wenn das nur Entlassungen im öffentlichen Dienst und Kürzungen der Sozialprogramme – genau dann, wenn sie am meisten gebraucht werden – bedeuten würde. Schließlich macht es die Struktur der kapitalistischen Produktionsweise unausweichlich, dass im Verlauf einer Krise Staatsausgaben eingespart werden. Denn im Gegensatz zu dem, was Keynesianer sagen, sind staatliche Maßnahmen letzten Endes durch die Wachstumsrate der Privatwirtschaft beschränkt – und nicht anders herum.
Aber in Wirklichkeit sind Sparmaßnahmen nie nur eine temporäre Reaktion auf die Krise. Sozialprogramme sind nicht nur gekürzt, sondern dauerhaft ausgesetzt oder komplett gestrichen worden. In vielen Ländern wird die Krise genutzt, um lange bestehende Rechte und Ansprüche zu zerstören, wie etwa das Recht sich zu organisieren. Diese Angriffe scheinen nicht nur zyklische Anpassungen in der sich entfaltenden Logik der kapitalistischen Produktionsweise zu sein. Im Gegenteil, sie scheinen Kernpunkte des Klassenkampfs des Kapitals darzustellen. Auf dieser Grundlage zieht man leicht den Schluss, dass Sparprogramme nur die Umverteilung des Reichtums von Löhnen zu Profiten kaschieren sollen.
Beließen wir unsere Analyse aber hierbei, kämen wir einer keynesianischen Position gefährlich nahe. Denn auch sie erkennt in den Manövern des Kapitals Bemühungen, den Reichtum zugunsten von Profiten umzuverteilen. Doch die Keynesianer gehen in ihrer Argumentation weiter und unterscheiden zwischen den kurzfristigen Interessen des Kapitals (dem Kampf um ein größeres Stück des kleiner werdenden Kuchens) und seinen langfristigen Interessen (gemeinsam mit den Arbeitern den Kuchen vergrößern). Handelten beide Klassen strategisch, würden sie, den Keynesianern zufolge, ihren Kampf um die Verteilung des Reichtums beenden. Mit anderen Worten: Es gäbe keinen Klassenkampf. Das Kapital würde sich bereit erklären, in die Ausdehnung der Produktion zu investieren, und die Arbeiter wären damit einverstanden, dass sich nur ein Teil des daraus resultierenden Produktivitätszuwachses in den Löhnen niederschlägt. Der Staat würde diese Übereinkunft in einer neutralen Art und Weise regulieren: Wann immer die Wirtschaft stagniert und die Parteien zu zanken beginnen, würde er die Zinsen senken und Kredite aufnehmen, um die Nachfrage anzukurbeln, und somit beiden Klassen etwas anzubieten haben. Sobald das Wachstum wieder einsetzt, würde er die Zinsen wieder anheben und seine Schulden zurückzahlen.
Zurzeit passiert natürlich etwas vollkommen anderes. Haben die Vertreter des Kapitals den Staat für ein kurzfristiges Umverteilungsprojekt übernommen – und so die Fähigkeit verloren, entsprechend ihren langfristigen strategischen Interessen zu handeln? Selbst wenn der sogenannte grüne Kapitalismus die ökologische Katastrophe nicht abwenden würde, wäre er mit Sicherheit immer noch eine phantastische PR-Kampagne für das Kapital. Trotzdem kommt er nicht richtig in Fahrt. Würde die Krise zu einem Ende kommen, wenn der Staat, wie Keynesianer verlangen, die Rufe nach Einsparungen ignorieren und stattdessen versuchen würde, mittels riesiger Investitionen in die Infrastruktur das Kapital zu einer Erneuerung seiner Übereinkunft mit den Arbeitern zu bewegen?
Auf diese Weise lässt sich die momentane Situation unseres Erachtens nicht begreifen. Der Kapitalismus ist inmitten einer tiefen Krise, welche beiden Klassen die objektiven Grenzen dieser Produktionsweise vor Augen führt. Diese Grenzen sind weder im Interesse einer der beiden Klassen – noch können sie durch Maßnahmen eines starken Staates überwunden werden. Im Gegenteil, es ist die Schwäche des Staates, die uns in den kommenden Monaten, mit einer so gut wie sicheren "double-dip"-Rezession, schmerzhaft bewusst werden wird. Christine Lagarde, die neue Chefin des IWF, bekundete kürzlich in der Financial Times ihre Beunruhigung über diese Entwicklung:
"Die heutige Situation ist eine andere als 2008. Damals war der schlechte Zustand der Finanzinstitutionen der Grund für die Unsicherheit. Heute sind es Zweifel am Zustand der Staaten (…) Damals bestand die Antwort in einer beispiellosen Lockerung der Geldpolitik, direkter Unterstützung des Finanzsektors und moderaten Konjunkturanreizen. Heute ist die Geldmarktpolitik eingeschränkter, die Probleme der Banken müssen erneut angegangen werden und die Krise hat eine Altlast an Staatsschulden hinterlassen - in den entwickelten Ländern sind sie durchschnittlich etwa 30% des BIP höher als vorher." (FT, 16. August 2011)
Was Lagarde nicht erwähnt, ist, dass die Staatsschuldenquote in den 'entwickelten Ländern' bereits vor 2008, als sie sich in Reaktion auf die Krise aufblähte, hoch war (siehe Tabelle). Am Vorabend der Großen Depression von 1929 lag die Staatsverschuldung der USA bei nur 16% des BIP; zehn Jahre später, 1939, war sie auf 44% gestiegen.1 Im Gegensatz dazu lag sie 2007 am Vorabend der aktuellen Krise bereits bei 62% und erreichte nur vier Jahre später den Stand von 99%. Die Ursache ist einfach auszumachen: Seit beinahe vier Jahrzehnten ist die Staatsschuldenquote in den einkommensstarken Ländern während der Krisen meist angestiegen (wie es die keynesianischen Rezepte vorsehen), in Boomphasen aber nicht wieder gesunken oder sogar weiter gestiegen. Liegt das an der schlechten Planung seitens der Eliten? Im Gegenteil, es liegt daran, dass die Boomphasen selbst, von Zyklus zu Zyklus, immer schwächer geworden sind. Im Ergebnis war der Staat nicht in der Lage, Zinssätze zu erhöhen oder seine Schulden abzuzahlen (allenfalls mit Unterbrechungen), denn jeder ernsthafte Versuch dazu hätte die immer zerbrechlicheren Wachstumsphasen gefährdet.2 Das stellt die Keynesianer vor ein Problem, da es auf eine strukturelle Schwäche der kapitalistischen Wirtschaft verweist – die der Staat nicht beheben kann.
Diese Schwäche setzt den Staat doppelt unter Druck. Erstens befindet er sich aufgrund der Fragilität der Wirtschaft in genau der Situation, die Keynes während der Großen Depression vor Augen hatte. In den letzten vier Jahren hat die US-Notenbank gemeinsam mit anderen Zentralbanken die Zinssätze für kurzfristige Anleihen bei ungefähr null Prozent gehalten. Trotzdem hat sich die Wirtschaft bislang nicht erholt. Das sollte eigentlich unmöglich sein: Die Wirtschaft sollte dieses kostenlose Geld für Investitionen nutzen, private Haushalte sollten damit Immobilien kaufen. Wenn heutzutage niemand mehr Geld leihen möchte, dann deswegen, weil alle bereits hoch verschuldet sind. Diese Schulden stammen natürlich aus den Jahren der „Finanzblase“(1998-2001 und 2003-2007), als sowohl Firmen wie wohlhabendere Familien den Wert ihrer Anlagen steigen sahen. Sie beliehen ihre steigenden Anlagewerte, um zu investieren oder große Anschaffungen zu machen – selbst als die Profite und Gehälter stagnierten.3 Jetzt, wo diese Anlagewerte dramatisch gefallen sind, versucht jeder Geld zu sparen und seine Schulden zu tilgen. Allerdings hat diese Sparorgie die Wirtschaft in Gefahr gebracht. Unter normalen Umständen bringen Firmen und Privatpersonen gespartes Geld auf die Bank, die es an andere Firmen und Privatpersonen verleiht, die das Geld wiederum ausgeben. So gesehen sinken die Ausgaben nicht. Sparen aber alle gleichzeitig, ist genau das der Fall und die Wirtschaft schrumpft. Der Unterschied zwischen der Großen Depression und heute besteht darin, dass die Regierungen diesmal eingesprungen sind, um diese Lücke durch Staatsausgaben auszugleichen – also durch fiskalische Anreize (auch wenn diese hauptsächlich in Erhöhungen bereits existierender Arbeitslosen- und Sozialleistungen bestehen). Während der ersten Jahre der Großen Depression tat die US-Regierung dies nicht und die Wirtschaft schrumpfte um 46 Prozent. Die fiskalischen Anreize haben heute somit eine andere Funktion als im Laufe eines normalen Wirtschaftszyklus. Ihr Zweck ist es nicht, das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln – dazu müssten die Leute das zusätzliche Geld auch tatsächlich ausgeben. Stattdessen nutzen sie es hauptsächlich, um ihre Schulden abzuzahlen. In der jetzigen Krise dienen die Staatsausgaben nur dem Zweck, Zeit zu gewinnen, um allen die Möglichkeit zur Schuldentilgung zu geben, ohne eine Deflation auszulösen – die die Anlagewerte drücken und die Schuldenlast folglich noch erhöhen würde. Aus diesen Gründen sind fiskalische Anreize heute die einzige Möglichkeit, die Wirtschaft vor dem Schrumpfen zu bewahren.4
Neben dem Druck, Geld auszugeben, lastet ein weiterer, ebenso starker, aber entgegengesetzter Druck auf dem Staat – der Druck zur Schuldensenkung. Entgegen den Behauptungen von Keynesianern haben die Staaten sehr wohl seit dem Ausbruch der Krise viel Geld ausgegeben. In den letzten vier Jahren hat die US-Regierung Schulden in einer Höhe aufgenommen, die nur knapp unter der gesamten nationalen Wirtschaftsleistung von 1990 lag – und das nur, um das Abgleiten in die Rezession zu verlangsamen. Das Problem ist, dass der Staat diese gewaltigen Schulden in einem historischen Kontext anhäuft, in dem er, wie die Unternehmen und Haushalte selber, bereits hochverschuldet ist.5 Dieser historische Kontext fehlt in den Betrachtungen der Keynesianer: Sie übersehen, dass die Schwäche der Wirtschaft in den letzten vier Jahrzehnten – die Tatsache, dass die Wirtschaft bereits vor der gegenwärtigen Krise immer langsamer gewachsen ist – heute die Möglichkeiten des Staates zur Verschuldung begrenzt. Das ist es, was Lagarde solche Sorgen bereitet. Die Staatsverschuldung ist bereits so hoch, dass es riskant ist, noch mehr Geld zur Stimulation der Wirtschaft auszugeben. Ausgaben in der jetzigen Situation verringern nur die ohnehin schwindende Fähigkeit des Staates, sich im Falle zukünftiger finanzieller Notsituationen zu verschulden. Sie könnten die Krise sogar beschleunigen, da die schnelle Zunahme der Staatsverschuldung das Gespenst des Staatsbankrotts wecken könnte.6 Unter diesen Umständen hat der Staat die Pflicht, sein Pulver trocken zu halten – also solange wie möglich seinen Zugang zu billigen Krediten aufrechtzuerhalten. Er wird diese Kredite nämlich für seine Versuche brauchen, die kommenden Wellen finanzieller Turbulenzen zu überstehen (etwa für weitere Bankenrettungen). In diesem Sinne sind Sparmaßnahmen absolut vernünftig. Dass sie gleichzeitig Deflation verursachen werden und so die Stabilität dessen, was sie stützen sollten, gefährden, ist ein realer Widerspruch, dem der Staat in dieser Phase ausgesetzt ist. Diese zwei Dringlichkeiten – Geld auszugeben, um Deflation abzuwenden, und Geld einzusparen, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden – sind in gleichem Maße unerbittlich. In der Tat offenbart sich die Krise gerade in den Bilanzbüchern unzähliger Staaten. So wie 2008 die Solvenz der Privatwirtschaft dadurch erhalten wurde, dass ihre Schulden in die öffentlichen Haushalte verschoben wurden, so gefährden die aktuellen Maßnahmen der Staaten zur Rettung ihrer eigenen Solvenz wiederum den privaten Sektor. Frei nach Marx: All dieses Jonglieren mit Schulden dient nur der Verschiebung der Insolvenzkrise auf ausgedehntere Sphäre, eröffnet ihr größren Spielkreis.
Gleichwohl müssen wir uns davor hüten, die Schwäche der kapitalistischen Produktionsweise für eine Schwäche des Kapitals in seinem Kampf mit den Arbeiter_innen zu halten. Krisen haben die Position des Kapitals im Klassenkampf noch immer gestärkt — und die keynesianische Vorstellung, dass der Staat das Kapital dazu bringen könnte, seinen Vorteil nicht auszunutzen, ist nichts als eine technokratische Phantasie. In einer Krise fällt die Nachfrage nach Arbeit genau dann, wenn ihr Angebot aufgrund von Entlassungen zunimmt. Schon das schwächt die Verhandlungsposition der Arbeiter_innen. Außerdem stimmt es zwar, dass das Kapital im Laufe eines Abschwungs Verluste macht, aber die einzelnen Kapitalisten geraten selten in die Art von existenzieller Not, mit der sich entlassene Arbeiter_innen konfrontiert sehen. Kapitalisten haben viel größere Reserven als Arbeiter_innen, so dass sie eine Krise normalerweise aussitzen können, gerade wenn die Nachfrage nach ihren Produkten gesunken ist. Aus all diesen Gründen müssen wir erkennen, dass die Krise die Position der Arbeiter_innen gegenüber dem Kapital geschwächt hat. Es ist also keine Überraschung, dass dessen Vertreter die Krise zu ihrem Vorteil nutzen und behaupten, dass diese oder jene Maßnahme notwendig sei, um die Profite wieder zu steigern. Die Profitrate wieder anzuheben, ist tatsächlich der einzige Weg zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Und solange die Arbeiterklasse nicht die Existenz der Klassengesellschaft schlechthin angreift, haben Arbeiter_innen kein anderes Interesse als einen Arbeitsplatz zu finden oder ihn zu behalten. Das sind die Schwierigkeiten, die sich in der kapitalistische Krise darstellen. Die Schwäche des Systems als Ganzes ist zugleich die Schwäche der Arbeiter_innen in ihrem täglichen Kampf mit dem Kapital – und nicht, wie man erwarten möchte, ihre Stärke. Wenn wir diese zwei Momente nicht auseinanderhalten, laufen wir Gefahr, die widersprüchliche Natur der Sparmaßnahmen in der momentanen Krise misszuverstehen.