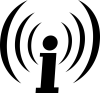Immer häufiger gehen Polizisten gegen Demonstranten mit Pfefferspray vor. Das ist gefährlicher, als die Regierung zugeben will
Tom Strohschneider
Göttingen im Januar 2011. Polizisten haben sich vor einer kleinen Demonstration postiert, der Einsatzleiter will Vermummte entdeckt haben. Doch die Linken wollen weiterlaufen, es kommt zu Rangeleien, man drückt voran, und plötzlich wird Pfefferspray in großem Bogen über die Köpfe verteilt.
Die Polizei setzt „im Wege des Sofortvollzugs das Reizstoffsprühgerät“, so wird es später das niedersächsische Innenministerium formulieren, „gezielt gegen einzelne Störer“ ein. Videobilder zeigen eine andere Wahrheit. „Ignorant“ nennt deshalb Hans-Georg Schwerdthelm von den Grünen die Reaktion der Landesregierung. Und auch bei der Göttinger Verdi-Jugend ist man empört. „Das weiträumige Sprühen von Pfefferspray in eine dichte Menschenmenge“, so wie am Leinekanal, sei „völlig unverhältnismäßig und unverantwortlich“.
Für die Behörden ist Pfefferspray ein „Mittel des unmittelbaren Zwangs“. Der Einsatz ist gesetzlich erlaubt, Ländervorschriften regeln das Nähere. In Baden-Württemberg zum Beispiel darf Pfefferspray „nur angewandt werden, wenn der polizeiliche Zweck auf andere Weise nicht erreichbar erscheint“. Und die Anwendung muss „nach Art und Maß dem Verhalten, dem Alter und dem Zustand des Betroffenen angemessen sein“.
An dieser Stelle beginnen die Probleme. Größere Probleme womöglich, als die Verantwortlichen bisher sehen wollen. Denn von einem verhältnismäßigen Einsatz durch die Polizei kann kaum sprechen, wer die Bilder aus dem Stuttgarter Schlosspark oder von der Castorstrecke im Wendland vor Augen hat: Immer häufiger gehen Polizisten vor allem bei Demonstrationen wahllos mit dem Reizstoff vor. Auf Youtube finden sich Dutzende Zeugnisse davon, wie wenig sich Beamte dabei um Vorschriften scheren und wie dadurch Menschen in Gefahr geraten. In potenziell tödliche Gefahr, wie Kritiker meinen.
Bis zu sieben Meter weit
Pfefferspray ist 1999 von der Innenministerkonferenz empfohlen worden und heute überall im Einsatz. Bis zu sieben Meter weit reicht der Strahl aus den Polizeigeräten. Wer getroffen wird, zeigt typische Symptome: Augenreizungen, vorübergehende Blindheit, Schmerzen, Atembeschwerden. Verantwortlich ist das synthetische Pelargonsäure-Vanillylamid beziehungsweise Oleoresin Capsicum, ein natürlicher Stoff, der auch für die Schärfe im Chili sorgt. Nur ist ein Polizei-Pfefferspray mehr als tausendfach wirksamer als etwa Tabasco-Soße. „Bei bestimmungsgemäßer Exposition von gesunden Personen sind in der Regel keine bleibenden gesundheitlichen Schäden zu erwarten“, sagt die Bundesregierung. Doch offenbar gibt es das, was man in der Politik gern ein Restrisiko nennt.
Kritiker jedenfalls weisen auf tragische Ausnahmen hin. Von „mindestens drei“ Toten nach dem Polizeieinsatz von Pfefferspray berichtet der Spiegel. Die Opfer hatten zuvor Drogen oder Psychopharmaka genommen. Im vergangenen Juni starb ein 32-Jähriger im Dortmund, nachdem Beamte versucht hatten, ihn mit Pfefferspray ruhigzustellen. In Berlin wird derzeit der Fall eines jungen Mannes neu aufgerollt, der Polizisten attackiert hatte, worauf diese mit Pfefferspray reagierten. Der 32-Jährige starb kurz darauf. Die Staatsanwaltschaft erklärt: „Todesursache war eine anaphylaktische Reaktion“, bei der wohl ebenfalls Pfefferspray und Drogen eine tödliche Wechselwirkung eingingen.
Womöglich ist das aber nur die Spitze des Eisbergs. Eine Studie aus dem Büro der Linken-Abgeordneten Karin Binder verweist auf den Rostocker Forensiker Fred Zack, laut dem Rechtsmedizinern oft gar nicht bewusst sei, dass Pfefferspray als Todesfaktor in Betracht kommt.
FDP-Abgeordneter sorgt sich
Die Sorge, das Mittel könnte weit gefährlicher sein als behauptet, treibt nicht nur Linke um. Ende November wandte sich der FDP-Abgeordnete Erwin Lotter an das Innenministerium. „Als Arzt und ordentliches Mitglied des Gesundheitsausschusses“, schrieb der Liberale, könne er „die durchaus begründeten Implikationen“ der Studie aus dem Binder-Büro „nicht ignorieren“. Zwar finde sich darin „oppositionelle Begleitmusik“. Trotzdem hält Lotter eine Prüfung der Risiken für „dringend geboten“ und fordert, „weniger komplikationsbehaftete Alternativen zu einem Einsatz von Pfefferspray“ in Erwägung zu ziehen.
Doch die Bundesregierung denkt bislang nicht daran. Es liege nun einmal „in der Natur der Sache“, antwortete das Innenministerium der Linksfraktion, dass mit „der Anwendung von Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt“ auch „gesundheitliche Beeinträchtigungen“ einhergingen. „Trotz Einzelrisiken“ müsse Pfefferspray daher „in der Palette polizeilicher Mittel beibehalten werden“ – auch wenn „bei einem kleinen Prozentsatz der Fälle eine gravierendere Gesundheitsbeeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann“.
Aber wie klein ist der Prozentsatz wirklich? Kritischere Risikoeinschätzungen gehen davon aus, dass eine erhöhte Gefahr „für Asthmatiker, Allergiker und blutdrucklabile Personen bzw. bei arterieller Hypertonie“ besteht. So teilt es jedenfalls der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags mit. Allein von Asthma sind etwa fünf Prozent der Erwachsenen betroffen, Experten rechnen mit 20 Prozent Allergikern in der Bevölkerung. Capsaicin kann zudem „bleibende Schädigungen der Hornhaut“ verursachen „wenn der Abschuss aus kurzer Distanz und mit einer hohen Austreibungswucht vorgenommen wird“. Das geschieht zum Beispiel beim Einsatz von Pepperball-Munition – wie zuletzt im Februar in Dresden gegen Demonstranten: Die Polizei schoss rote Kapseln aus einem dünnen Kunststoff teils im Dauerfeuer auf die Nazi-Gegner, wie Videos zeigen. Die Geschosse zerspringen am Körper und setzen Capsaicin-Staub frei.
"Keine Erkenntnisse"
Zwar beruft sich die Regierung darauf, vor der Einsatz-Empfehlung von 1999 habe es „eine intensive Studie des Polizeitechnischen Instituts“ Münster gegeben – doch dabei wurden offenbar nur „Gutachten, Fachliteratur und internationale Erfahrungen ausgewertet“. Auch eine „Statistik über etwaige Verletzungen (...) wird nicht geführt“. Und was den Einsatz von Pepperball-Munition angeht, liegen zumindest der Bundesregierung „keine Erkenntnisse zu Untersuchungen über die Gesundheits- und Lebensgefährdung“ vor.
Auf so einem schmalen Grat dürfe die Polizei nicht wandeln, meint die Linke. Und sie steht damit nicht allein. Er habe noch „die erschreckenden Bilder vor Augen“, sagt der SPD-Abgeordnete Wolfgang Gunkel mit Blick auf Stuttgart. „Offenkundig“ sei es, dass Pfefferspray an jenem Septembertag unverhältnismäßig eingesetzt wurde. Auch der Grünen-Politiker Wolfgang Wieland warnt davor, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Wunsch, Pfefferspray könne die Ausübung des unmittelbaren Zwangs „auf schonendere Weise ermöglichen“ als etwa CS-Gas, habe sich offenbar nicht erfüllt. Wieland fordert „aussagekräftige, ehrliche Studien“ und gegebenenfalls Alternativen. „Jeder Schwerverletzte ist einer zu viel, und Tote darf man schon gar nicht in Kauf nehmen.“
CDU: Alles nur Unterstellung
Nicht die Gefahr, sondern die Warnung davor hält dagegen der Unions-Abgeordnete Günter Baumann für „beschämend“ und weist entschieden die „Unterstellung“ zurück, Beamte würden Pfefferspray „leichtfertig, expansiv und unverhältnismäßig“ anwenden. Allerdings lassen selbst die offiziellen Zahlen einen anderen Schluss zu. Allein nach dem Castoreinsatz im vergangenen November bestellten Bundespolizisten fast 2.200 Reizstoffsprühgeräte nach. Wie viele Pfefferspraydosen die eingesetzten Landespolizeien leer geschossen haben, ist da noch nicht eingerechnet. Und vielleicht sollte sich CDU-Mann Baumann noch einmal die Bilder vom Herbst anschauen, als das Rote Kreuz später 130 Verletzte zählte und sich über 300 Menschen an einem einzigen Nachmittag wegen Reizungen durch Pfefferspray behandeln ließen:
Stuttgart im September 2010. Tausende sind in den Schlosspark gekommen, Schüler und Pensionisten protestieren gegen S21. In der Nähe eines Polizei-LKW stehen Menschen, man hört Trillerpfeifen, und plötzlich kommt eine Einheit schwarz gekleideter Beamter hinzu. Ein aggressiver Glatzkopf schiebt, droht mit dem Schlagstock und schlägt dann auf ein paar Jugendliche ein. Die rangeln zurück, rufen „Haut ab!“ Einer der Polizisten nimmt eine schwarze Dose in die Hand: Pfefferspray. Ohne Vorwarnung geht der Strahl in die dichte Menge. Meterweit und in großem Bogen.