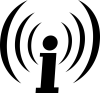Die meisten alten jüdischen Freiburgerinnen und Freiburger leben aus Angst vor Übergriffen lieber unerkannt.
Erika Herz* (Name von der Redaktion geändert) möchte ihre Geschichte
eigentlich gar nicht erzählen. Die alte Dame wurde in der Nazizeit als
Jüdin verfolgt, im Holocaust wurden fast alle ihre Verwandten ermordet,
sie selbst verbrachte ihre Kindheit im Exil in Südafrika – und erzählt
heute niemandem in ihrer Freiburger Senioren-Wohnanlage davon. Denn
unter ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern dominieren beim Rückblick
auf das eigene Leben vor allem nostalgische Gespräche oder traumatische
Erinnerungen, über Flucht, die "deutsche Niederlage 1945" und den
"Freiburger Bombenkrieg".
Mit dem Thema, das ihr Leben bestimmt, ist Erika Herz in dieser Umgebung
vermutlich allein. Sie fühlt sich nur sicher, wenn sie ihre eigene
Geschichte versteckt. Zum Beispiel, dass es in Südafrika keine Kirschen
gab. Wenn Erika Herz jetzt zu ihrem Geburtstag einen Kirschkuchen
geschenkt bekommt, ist das für sie ein Aufholen. Doch sie weiß: "Ein
Ozean voller Kirschen wäre nicht genug, um die Zeit im Exil wieder
nachzuholen."
Austauschen könnte sie sich leichter mit Holocaust-Überlebenden und
politisch Verfolgten. Doch jüdische Einrichtungen wie die
Seniorenwohnanlage Budge-Stiftung in Frankfurt am Main gibt es in
Freiburg mangels Nachfrage nicht.
Nach Aussage von Uschi Amitai, der ehemaligen Vorsitzenden der jüdischen
Gemeinde, wollen die meisten jüdischen Freiburger nicht an die
Öffentlichkeit treten, auch wegen Angriffen gegen Juden in anderen
Städten. Grund seien außerdem Erfahrungen mit Antisemitismus in der
ehemaligen Sowjetunion – 95 Prozent der Mitglieder der Freiburger
jüdischen Gemeinde kommen aus den GUS-Staaten. Uschi Amitai: "Wir hatten
vorgeschlagen, jüdische Gemeindemitglieder in einer Senioren-Wohnanlage
zusammen zu bringen; aber daraus wurde nichts."
Die heutigen Bewohner von Seniorenwohnanlagen und Pflegeheimen in
Deutschland wurden in der Nazizeit sozialisiert, viele haben den Krieg
direkt erlebt. Andrea Jandt, Chefin des St. Marienhaus in der Talstraße,
erzählt, wie englische Musik von manchen Bewohnern abgelehnt wird,
"weil Freiburg von den Engländern im Krieg bombardiert wurde". Diakon
Josef Glaser, Leiter des Wohn- und Pflegeheims in Kirchzarten, hat in 30
Arbeitsjahren immer wieder Bewohner erlebt, die am Ende ihres Lebens
von schlimmen Erinnerungen an eigene Taten eingeholt wurden. Auch eine
"Unverbesserliche" habe es gegeben, eine frühere Mitarbeiterin der
Gestapo Paris, die aus ihrer braunen Vergangenheit und ihrer immer noch
braunen Gesinnung keinen Hehl machte.
Zu einem Zivi habe sie gesagt: "So was wie Sie hätten wir früher
vergast." Er hat aber auch Menschen erlebt, die früher im Widerstand
gegen das Nazi-Regime waren, und solche, die ihre Biografie nie
verbargen: "Er war Jude. Sie war Christin und wurde von ihrer eigenen
Schwester bei der Gestapo angezeigt. Das Paar konnte gerade noch
rechtzeitig nach Brasilien flüchten."
Folkmar Biniarz, Leiter des Freiburger Pflegeheims Senovums, berichtet
von einer Holocaust-Überlebenden, die unter schweren Verfolgungsängsten
litt. Mit der Begründung ,Alles Mörder dort' war sie, die mehrere
Konzentrationslager überlebte, von einer anderen Einrichtung ins Senovum
gewechselt. Besonders nachts wurden die Erinnerungen an ihre
traumatischen Erlebnisse im KZ wach. Biniarz: "Sie wollte, dass unser
Pflegeheim mit Sicherheitskräften gut überwacht wird, sah sich jedoch
überall von Vergewaltigern umzingelt." Die Bewohnerin ist vergangenes
Jahr in die Budge-Stiftung nach Frankfurt umgezogen. In anderen
Einrichtungen scheint das Problem weniger bekannt zu sein. Christa
Varadi, Direktorin des St. Carolushaus: "Antisemitische Angriffe in
dieser Altersgruppe kommen in unserer Einrichtung nicht vor."
Wenn alte Menschen ins Wohn- oder Pflegeheim ziehen, fragen die
Leitenden der Einrichtungen nach ihrer Biografie. Andrea Jandt: "Es
hängt von den Bewohnern ab, ob sie etwas preisgeben – oft wissen aber
nicht mal die eigenen Kinder Bescheid." Einige Einrichtungen berichten
von ihren Schwierigkeiten, mit den wenigen Holocaust-Überlebenden
adäquat umzugehen. Jandt erzählt: "Wir haben über viele Jahre eine Frau
betreut, die als Jüdin im KZ war und überlebt hat. Weil sie inzwischen
dement war, konnten wir mit ihr das Erlebte nicht besprechen, aber ihr
das Gefühl geben, dass wir für sie da sind."
Die Zeitzeugen des Krieges sind inzwischen um die 90 Jahre alt. In
wenigen Jahren wird diese Generation der Täter und der Opfer nicht mehr
leben. Doch das Thema lebt in den Nachgeborenen weiter, denn auch die
Nachfahren der Verfolgten tragen das Trauma ihrer Eltern in sich.