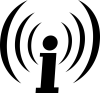Wo steht die Aufklärung über das neonazistische Terrornetzwerk NSU in Sachsen? Kerstin Köditz im Gespräch
Man hört über den zweiten Ausschuss sehr viel weniger als über den ersten. Warum ist das so?
Da sage ich ganz nüchtern, das Thema ist ein bisschen ermattet. Am
Anfang, so etwa 2012, gab es ein riesiges Interesse auch von Medien. Das
hat nachgelassen. Heute ist es so, dass es auch viel weniger
ZuschauerInnen im Ausschuss gibt, obwohl wir ja gerade darauf setzen,
dass die Zeugenvernehmungen so weit wie möglich öffentlich stattfinden
können. Damals war alles neu, auch für uns natürlich, und vieles von
dem, was neu klang, war wirklich spektakulär. Ich denke an das
absichtliche Vernichten und zufällige Wiederauffinden von Akten. Ich
denke auch an die dubiose Rolle von V-Leuten. Das ist aber ein
Dauerskandal geworden, einfach weil die Missstände, die da ans Licht
kommen, so massiv sind. Nur ein Beispiel: Genau wie ein paar andere
Ausschüsse haben wir uns in Sachsen ausführlich mit der verbotenen
»Blood & Honour«-Organisation auseinandergesetzt, einem Netzwerk,
aus dem heraus mehrere Neonazis das sogenannte Trio unterstützt haben.
Wir dachten, dass wir das gut ausgeleuchtet haben. Jetzt, Jahre danach,
kommt durch Medienrecherchen raus, dass sogar der Deutschland-Chef von
»Blood & Honour« ein V-Mann war. Das hat mich jetzt auch nicht mehr
vom Hocker gehauen: Was in so einer Dauerschleife läuft, wird irgendwann
»gewöhnlich«. Und in diese Schleife geht leider mit ein, dass wir es in
Sachsen auch ohne NSU wieder mit Rechtsterrorismus zu tun haben.
Kommt bei der Ausschussarbeit denn überhaupt noch etwas Neues raus?
Ja, definitiv. Soweit das aber Teil der laufenden Beweisaufnahme ist,
darf ich das noch nicht genauer bewerten, das geht erst am Schluss. Ich
will es aber gern an ein paar Beispielen illustrieren. Nehmen wir eine
Sache, die schon vor ein paar Jahren für Furore sorgte: Kurz, nachdem
Zschäpe am 4. November 2011 aus der Frühlingsstraße floh, gingen auf
ihrem Handy merkwürdige Anrufe ein. Diese Anrufe kamen von verschiedenen
Anschlüssen, die zum Teil auf das sächsische Innenministerium
registriert waren. Das hat natürlich die Phantasie beflügelt: Wie kam
man so schnell an die Handynummer von Zschäpe, und wer hat versucht, sie
ganz dringend zu erreichen? Sachsens Innenministerium hatte bald eine
Erklärung parat: Eine Nachbarin soll die Nummer gekannt und sie der
Polizei gegeben haben. Wir haben das mithilfe von Zeuginnen und Zeugen
nochmal detailliert aufgerollt, und siehe da: Die ominöse Nachbarin
war’s gar nicht. Wir haben auch Beamte vorgeladen, die selbst versucht
haben, die Zschäpe-Nummer anzurufen, denn die Ministeriums-Anschlüsse
waren Diensttelefone mehrerer Polizeidienststellen. Die Gründe für die
Anrufe können wir jetzt ganz gut nachvollziehen und auch plausibel
rückschließen, wie man an die Nummer kam. An alledem ist in meinen Augen
auch gar nichts Geheimnisvolles. Aber man hatte trotzdem versucht, uns
mit einer Story abzuspeisen, die so nicht stimmt.
Heißt: Mit mehr Elan bei den Behörden wäre in dem Punkt vielleicht kein Untersuchungsausschuss nötig gewesen?
Ein Defizit bei der Aufarbeitung durch Behörden ist in meinen Augen ganz
klar, dass es in Sachsen keine Stelle gab, wo man Akten und
Informationen zum Thema zentral recherchiert und ausgewertet hätte -
unter anderem auch, um Fehlinformationen aus der Welt zu schaffen. Mit
denen musste sich dafür schon manches Mal der Ausschuss plagen. Das
Beispiel mit den Telefonanrufen zeigt, dass die Zweifel, die auch die
öffentliche Berichterstattung prägten, eben nicht ganz unbegründet
waren. Das ist auch nicht das einzige Beispiel, nehmen wir die
Raubüberfälle in Chemnitz und Zwickau. Offizielle Erzählung ist: Die
Täter haben bei keinem der Taten Spuren hinterlassen, die es erlaubt
hätten, die Fälle aufzuklären. Das ist vermutlich nicht falsch, aber aus
den Akten heraus hat sich für mich ein großer Vorbehalt entwickelt.
Denn es gab seinerzeit Spuren, die man nicht zuordnen konnte und von
denen wir nachträglich nicht mal sagen können, ob sie ordentlich
ausgewertet wurden.
Das Problem ist nämlich: Diese Spuren sind verloren gegangen und nicht mehr bei den Akten, die uns gegeben wurden. Oder nehmen wir die merkwürdige Geschichte mit dem Waffenkoffer: Da sucht ein Referatsleiter des Landesamtes für Verfassungsschutz im Jahr 2000 in Chemnitz nach Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe. Und genau in der Zeit gibt es eine »Quelle« dieses Amtes, die in der Naziszene unterwegs ist, aus irgendeinem Grund einen Koffer voller Schusswaffen beschafft, ihn dann bei diesem »Verfassungsschützer« abgibt, der dann wiederum den Ermittlungsbehörden nicht verrät, woher die Waffen ursprünglich stammen. Man muss bedenken: Dass das sogenannte Trio nach Waffen sucht, wusste das LfV schon zwei Jahre vorher durch V-Mann-Berichte aus Brandenburg. Und heute wissen wir, dass der NSU mehr als 20 scharfe Schusswaffen hortete. Nur bei einem Teil davon kann man einigermaßen nachvollziehen, wie der Beschaffungsweg ging. Das Innenministerium und das LfV haben diesen dubiosen Vorgang jahrelang beschwiegen, ehe wir selbst darauf gestoßen sind. Und untersucht, ob man damals vielleicht in die Nähe einer Waffenquelle des NSU gekommen war, hat man nie.
Wir reden viel über Taten und Täter, auch über mögliche Helferinnen und Helfer. Wie geht der Ausschuss mit den Betroffenen der NSU-Taten um?
Wir arbeiten heraus, dass es in Sachsen überhaupt Betroffene gegeben
hat. So eine landläufige Vorstellung ist ja: Sachsen war ein ruhiger
Heimathafen für den NSU, hier hat er sich perfekt getarnt, ist nicht
angeeckt, war deswegen nicht zu erkennen. Aber so ganz stimmt das nicht.
Bei dem Brand und der Explosion in der Frühlingsstraße am 4. November
2011 wurde eine betagte Nachbarin, die von dem Feuer selbst nichts
mitbekam, noch knapp gerettet. Bei allen der elf Raubüberfälle in
Chemnitz und Zwickau, die heute dem NSU zugerechnet werden, drohten die
Täter mit dem Einsatz von Waffen und der Tötung von Angestellten, zum
Teil auch der Kunden. In vier dieser Raubfälle gab es insgesamt neun
Verletzte. Bei drei der Überfälle wurde geschossen, davon zumindest zwei
Mal scharf. In einem Fall überlebte ein angeschossener Auszubildender
einer Sparkasse-Filiale nur mit Glück. Mir scheint, der NSU ist da
ständig »aufs Ganze« gegangen und hat Tote auch hier in Sachsen
billigend in Kauf genommen.
Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Und dieser blinde Fleck erleichtert es natürlich auch der Mehrheitsbevölkerung, sich mit dem NSU nicht zu befassen - denn die Opfer, das waren ja immer andere, »nur« Fremde, und die Anschläge hatten mit Sachsen nichts zu tun. Ein ganz bezeichnendes Bild davon hat uns die Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeiß gemalt, die wir als Zeugin in den Ausschuss geladen hatten. Sie hat uns detailliert beschrieben, was für einen schweren Stand das Vorhaben hat, in Zwickau einen Gedenkort für die Betroffenen des NSU-Terrors zu schaffen. Es gibt so einen Gedenkort bis heute nicht. Es gab zwischenzeitlich öffentliche Kunstinstallationen engagierter Leute, die genau auf diesen Mangel hinweisen wollten. Sie wurden von Unbekannten zerstört, bei denen wohl naheliegt, aus welcher Ecke sie kommen. Auch deshalb machen wir uns für ein offizielles öffentliches Gedenken stark, das sich auf die Seite der Betroffenen stellt. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein.
Zum NSU kursieren viele Verschwörungstheorien. Wie geht der Ausschuss damit um?
Da sind wir in Sachsen gebrannte Kinder, im ersten Ausschuss war ja die
NPD vertreten. Zur Aufklärung hatte sie nichts beizutragen, umso
pompöser kam ihr Abschlussbericht daher. Man kann das kurzfassen: Den
NSU habe es nie gegeben, das alles sei ein Geheimdienstkonstrukt, um der
rechten Szene und natürlich in erster Linie der NPD zu schaden. Belege
gibt’s dafür weit und breit nicht. Aber das ist in der extremen Rechten
bis heute die beliebteste Lesart, natürlich auch, weil sie einen von
jeder eigenen Verantwortung entlastet.
Aber mal abgesehen von diesem Spektrum werden im Internet Geheimakten geleakt, die eine andere Geschichte erzählen als das, was offiziell über den NSU berichtet wird.
Das ist vor allem der »Arbeitskreis NSU«. Dort wurden
Ermittlungsunterlagen veröffentlicht, die augenscheinlich vom
Bundeskriminalamt stammen. Streng genommen ist das kein »Leak«, denn
solche Unterlagen sind vielen Leuten von Berufs wegen zugänglich und gar
nichts davon war je geheim. Daraus ergibt sich dann jedenfalls ein ganz
kleiner, unvollständiger und inzwischen hoffnungslos veralteter
Ausschnitt der Polizeiarbeit vor fünf Jahren, noch vor Beginn des
Münchner NSU-Prozesses. Und das mischt sich dann mit blühender
Phantasie: Diese Leute haben zum Beispiel immer wieder behauptet, dass
in dem Wohnmobil, in dem Mundlos und Böhnhardt am 4. November 2011
aufgefunden wurden, gar keine Fahrräder waren, die beide Männer kurz
zuvor für einen Banküberfall genutzt haben sollen. Klang richtig
spannend, war aber ein Fake. Ärgerlich und völlig inakzeptabel ist, dass
durch haltlose Berichte immer wieder Opfer, ZeugInnen und Betroffene
gedemütigt und in irgendwelche fantastischen Erzählungen verstrickt
werden. Unterm Strich kommt dabei nichts raus, was zur Aufklärung
beiträgt. Das ist ja der Witz dabei: Diese selbst ernannten Aufklärer
sind selbst die größten Desinformanten. Von den rassistischen
Untertönen, die dabei angeschlagen werden, mal ganz zu schweigen.
Aber ist es fair, jede steile These von vorn herein als »Verschwörungstheorie« abzuqualifizieren? Sie sagen ja selbst: Bei keinem Bankraub gab’s eine echte Spur zum NSU.
Die Belege, die man heute für die Täterschaft von Mundlos und Böhnhardt
bei den Banküberfällen kennt, sind meines Erachtens erdrückend. Nicht
mal Zschäpe bestreitet das. Für uns ist das aber nicht der Fokus, das
ist die Aufgabe von Polizei und Justiz. Offen sind für uns andere
Fragen: Hat das Geld aus den Überfällen gereicht für die Ausgaben, die
für die Gruppe zu tragen waren? Wurde da vielleicht Geld gewaschen oder
anders umgesetzt, und wenn ja, was für weitere Strukturen hingen mit
drin? Auch wir bilden Thesen und - darauf kommt es an! - versuchen, sie
zu prüfen. Dass unsere Möglichkeiten Grenzen haben, ist klar.
Das ändert nichts daran, dass weitgehende Behauptungen nicht nach möglichst spektakulären Interpretationen verlangen, die man lautstark verbreitet, sondern nach besonders haltbaren Belegen, an die man erst mal kommen muss. Dazu gibt es keine Alternative. Denn wenn wir das Geschehen im NSU-Komplex plausibel deuten wollen, müssen wir zuallererst die Tatsachen kennen, die liegen noch immer nicht alle auf dem Tisch. Was das angeht, sind wir meiner Meinung nach eben weit davon entfernt, irgendwelche umfassenden Theorien aufstellen zu können, wie es angeblich wirklich war. Richtig ist, dass wir es bei dem Thema mit vielen »offenen Enden« zu tun haben, mit Widersprüchen in den Akten und auch in dem, was manche ZeugInnen aussagen. Daran sind zum Teil Behörden schuld, weil sie darauf verzichten, Unstimmigkeiten auszuermitteln und dann öffentlich geradezurücken. Diese Polizei-Anrufe bei Zschäpe am 4. und 5. November 2011 sind ein klassisches Beispiel dafür.
Das klingt nach Säumigkeit. Aber zeichnet sich unterm Strich so etwas wie Behördenversagen oder eine Vertuschung tatsächlich ab?
Säumigkeit will ich nicht sagen. Wir haben ja, auch durch den ersten
Ausschuss, ganz unterschiedliche Beamte kennengelernt, einige waren
beeindruckend motiviert, fachlich hochversiert und in ihrer Arbeit
unnachgiebig. Es gab andere, wo ich das nicht behaupten kann. Diese
Unterschiede sind nicht überraschend, ich denke allerdings, dass sie
hier nicht sehr erklärungskräftig sind. Denn nach dem ersten
Untersuchungsausschuss war für uns klar, und das haben wir auch so in
unserem Abschlussbericht formuliert: Mit den Informationen, die in der
Zeit von 1998 bis 2000 vorlagen oder ermittelt werden konnten, wäre es
höchstwahrscheinlich möglich gewesen, die Flüchtigen zu finden. Das
Versagen besteht in erster Linie darin, dass das nicht passiert ist. Die
Frage ist, warum nicht - und dass wir das bis heute nicht beantworten
können, ist das eigentlich Beunruhigende. Da stießen Beamte mehrerer
Behörden ganz zeitig auf Chemnitz, wo sich das Trio wirklich versteckte,
überwachen mehrere Leute, die das Trio vermutlich wirklich unterstützt
haben und observieren schließlich ein Haus, in dem das Trio nach der
Flucht tatsächlich untergekommen war. Durch Über- oder Untereifer allein
kann das nicht gut erklärt werden, fürchte ich. Mir persönlich geht es
bei der Ausschussarbeit auch darum, dass wir uns dieser Fragen, diesen
losen Enden und inneren Widersprüchen, weiter annähern können.