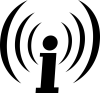Die Zahl rechtsextremer Ausschreitungen und Gewaltakte nimmt deutlich zu, vor allem in Ostdeutschland. Forscher haben nun drei Orte näher untersucht. Die Ergebnisse sind besorgniserregend.
Brandsätze in Flüchtlingsheimen, Hetzjagden auf Ausländer, fremdenfeindliche Kundgebungen: Die Zahl rechter Aktionen und Straftaten steigt - und in den Statistiken stechen die sogenannten neuen Länder besonders hervor. Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben ein ernstes Problem mit Rechtsextremismus. Der aktuelle Regierungsbericht zum Stand der Deutschen Einheit sieht darin "eine große Gefahr" für die Entwicklung der gesamten Region.
Nun hat ein Forscherteam diese Entwicklung für die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke (SPD), näher untersucht - in drei ausgewählten Orten, in denen das Ausmaß rechtsextremer Straftaten seit 2015 auffällig gestiegen ist. Vier Wissenschaftler des Göttinger Instituts für Demokratieforschung gingen monatelang in Freital, Heidenau und dem Erfurter Stadtteil Herrenberg der Frage nach, welches Ausmaß rechtsextreme Einstellungen dort haben.
Das Team unter Leitung des Politologen Franz Walter führte knapp 40 leitfadengestützte Einzelinterviews unter anderem mit Politikern, Wissenschaftlern und Anwohnern. Ergänzt wurden diese Gespräche durch sogenannte Fokusgruppen, teilnehmende Beobachtung sowie Dokumenten- und Materialanalysen.
"Aber es wäre verfehlt", schreiben die Wissenschaftler, "Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und fremdenfeindliche Übergriffe als ein primär ostdeutsches oder gar vor allem sächsisches Problem zu verorten." Die Erkenntnisse ihrer Studie ließen sich nicht auf ganz Ostdeutschland ausweiten - denn für jeden Ort gebe es spezifische Gründe für die Ausbreitung rechtsextremen Gedankenguts.
Die zentralen Ergebnisse im Überblick:
- Streben nach Ordnung: Der Studie zufolge gibt es den "Wunsch nach einer kollektiven, möglichst positiven und moralisch reinen Identität" - der sei mitunter so stark, dass historische Tatsachen wie rechtsextreme Übergriffe schon zu DDR-Zeiten schlichtweg ausgeblendet würden.
- Gefühl der Demütigung: Viele Menschen sehen sich laut der Studie in einer Opferrolle: Als Bewohner des ländlichen Raums fühlen sie sich von Städtern verunglimpft, als Ostdeutsche werfen sie den Westdeutschen Überheblichkeit vor, als Deutsche fühlen sie sich von Einwanderern übervorteilt - und sie spüren wegen rechter Umtriebe in ihrer Heimat zusätzlich Rechtfertigungsdruck. Dieses Gefühl bestärke die Ablehnung, sich mit dem Problem des Rechtsextremismus auseinanderzusetzen.
- Ethnische Homogenität: Da im ländlichen Raum in Ostdeutschland kaum Ausländer leben, sehen der Studie zufolge viele Menschen dort nur Deutsche als Benachteiligte. Im Westen des Landes würden demnach schon Schulkinder erfahren, dass Migranten keineswegs privilegierte "Sozialschmarotzer" sind. In den neuen Ländern hingegen komme es mangels Zuwanderern nur selten zu solchen Schlüsselerlebnissen.
- Prägende Vergangenheit: Die geschlossene DDR-Gesellschaft hat der Studie zufolge große Auswirkungen auf die Gegenwart. Bis heute hätten damals geltende Prinzipien nachhaltige Wirkung: "Völkerfreundschaft ja, aber alle Migranten sind als Gäste zu betrachten." Diese Sichtweise habe sich eingebrannt.
- Entpolitisierung des Alltags: Da der SED-Staat weite Teile des Lebens durchdrang, würden sich viele Ostdeutsche seitdem von zivilgesellschaftlichen und politischen Organisationen fernhalten, so die Forscher. Anstelle des Zwangskollektivs sei aus deren Perspektive eine Gesellschaft isolierter Einzelkämpfer gerückt - und ein aus dem Westen importiertes Polit-Spektakel, das sich kaum für sie interessiere. Der Staat muss sich in diesem Weltbild einerseits um faktisch alle Probleme kümmern, ist andererseits aber stets zu weit weg. Bürgerschaftlichem Engagement stünden viele Befragte ebenso skeptisch gegenüber wie der Parteienvielfalt, "die die Identität von Volk und Staat vermeintlich untergräbt".
- Mangelnde politische Bildung: Auffällig sei das vergleichsweise geringe Ausmaß politischen Wissens - auch in diesem Fall vor allem in Sachsen. Damit lasse sich erklären, warum es nur wenig Widerstand gegen die Ausbreitung rechtsextremer Einstellungen gibt. "Dabei handelt es sich", heißt es in der Studie, "um eines der wenigen Probleme, die (mit etwas politischem Willen) relativ leicht zu beheben wären."
Der Umgang mit diesen Problemen unterscheide sich je nach Ort zum Teil stark. Im Dresdner Umland, vor allem in Freital, haben die Forscher eine "Infantilisierung" von rechtsextremen Tätern und eine Relativierung ihrer Taten festgestellt. Ganz anders sieht es in Erfurt aus, wo sich im Stadtrat ein breites Bündnis gegen Rechtsextremismus gebildet hat. Die Autoren der Studie sehen darin ihre Kernthese bestätigt: Rechtsextremismus ist nicht nur ein Ost-West-Problem - sondern eines, das strukturschwache Orte deutlich stärker betrifft als größere Städte.
Die zum Teil massiven Missstände ließen sich nicht nebenbei angehen, schreiben die Politologen - sondern bedürften "eines ganzen Bündels an Maßnahmen". Dazu zählen: eine gezielte Sozialpolitik, ein ehrlicher Umgang mit Rechtsextremismus auf politischer Ebene, mehr Mitmach-Möglichkeiten für Bürger - und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der DDR-Vergangenheit.
Strukturschwache Regionen müssten gezielt gefördert werden, sagt die Ostbeauftragte Gleicke. "Einen Rückzug des Staates aus ganzen Landstrichen darf es nicht geben." Jedoch sollten Lösungsvorschläge mit erhobenem Zeigefinger aus dem "vermeintlich so viel weltoffeneren Westen der Republik", so Gleicke, tunlichst unterbleiben.
Auch die Göttinger Forscher warnen vor pauschalem Ostdeutschland-Bashing. Denn abgesehen davon, dass es Rechtsextremismus auch in anderen Landesteilen gebe, lebten in Heidenau, Erfurt-Herrenberg oder Freital selbstverständlich nicht nur Rassisten: In all diesen Orten, schreiben die Forscher, hätten sie auch engagierte Bürger getroffen.