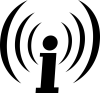Er hat keine Hoffnung mehr in dieser Nacht, er greift zum Formular C2001 und zum Stift. Er verfasst die beiden letzten Briefe seines Lebens. „Ich küsse euch“, schreibt er in seiner Zelle im Gestapo-Gefängnis in Berlin-Moabit an seine Frau Marigard und an seinen Sohn Christian, 13 Jahre alt. „Ich kann nur hilflos weinen. Ich weiß, dass Ihr beide in Liebe an mich denkt, und ich flüstere Euer beider Namen oft ins Dunkle.“ Wenig später, um sechs Uhr morgens am 6. April 1944, findet der Nachtdienstbeamte den Zeichner Erich Ohser alias e.o.plauen tot am Fenstergitter, aufgehängt am Handtuch, 41 Jahre alt. Am selben Tag wartete der Volksgerichtshof auf ihn. Roland Freisler persönlich, der oberste Nazi-Scharfrichter, sollte auf Wunsch Joseph Goebbels’ über Ohser richten – wegen „Wehrkraftzersetzung“. Ohser wusste, dass der Tod auf ihn wartete – und kam ihm zuvor.
Der zweite Brief ging an seine Henker. „Sie können stolz sein, der Mörder des Vaters von ,Vater und Sohn‘ zu sein“, schreibt er ironisch. „Möge der Fluch von hunderttausend Kindern auf Sie herab kommen. Mörder, Mörder, Mörder!“
Es ist das grausame Ende eines Künstlers, der zeitlebens schwankte zwischen höchstem Triumph als millionenfach verehrter Humanist und Freigeist und den tiefsten Tiefen als depressiver, lebensängstlicher Zweifler und Geächteter. Am Ende wird er von zwei Nachbarn in Berlin-Kaulsberg, dem Hauptmann Bruno Schultz und seiner Frau Margarete, an die Gestapo verraten. Seitenlang protokollierte das Denunziantenpaar, wie Ohser und sein Freund Erich Knauf in einer Berliner Bombennacht „in gehässiger und zersetzender Weise führende Männer des Staates beschimpfen“. Knauf wird im Mai 1944 hingerichtet.
Ohser ist tot. Aber seine berühmtesten Geschöpfe überleben den Krieg, die Jahrzehnte. Bis heute haben „Vater und Sohn“ – millionenfach gedruckt bis nach China und in den Iran – nichts von ihrer universalen Wirkung, ihrer Wärme und Herzlichkeit verloren. Nun erscheint eine Fortsetzung: „Neue Geschichten von Vater und Sohn“. Gleichzeitig hebt sich, 71 Jahre nach seinem Tod, der Schleier über dem Leben des Schöpfers: Elke Schulze aus Plauen, Vorsitzende der Erich-Ohser-Stiftung, hat aus Briefen, Skizzen und Zeugnissen erstmals ein komplexes Bild von Ohser zusammengesetzt. „Sein Schicksal steckt voller Extreme und Widersprüche“, sagt sie. Es lasse sich „nicht so einfach in Schemata wie Opfer und Täter einfügen“. Die Gründe für den zeitlosen Erfolg von „Vater und Sohn“ sieht sie in „ihrer Fähigkeit, aus den Zumutungen und Malheuren des Alltags ein gemeinsames Abenteuer zu machen“. Sie seien eben „keine Superhelden, sondern Repräsentanten der Lebensfreude, sie stehen für die Möglichkeit des Glücks“.
Es ist freilich ein mutiges Unterfangen, das Erbe dieses Mannes anzutreten, der 1903 als Sohn von Paul und Paula Ohser in Untergettengrün an der böhmisch-sächsischen Grenze im Vogtland geboren wird. 1907 zieht die Familie nach Plauen, Erich macht eine Schlosserlehre und beginnt dann ein Abendstudium an der Akademie für grafische Künste und Buchgewerbe in Leipzig.
In seinem harten, kratzigen Strich zeichnet er wie besessen; Vignetten, Witzbilder, Illustrationen, Akte. 1922 wird Erich Knauf auf ihn aufmerksam, Redakteur der sozialdemokratischen „Volkszeitung für das Vogtland“ in Plauen. 1923 dann lernt er Erich Kästner kennen, der gerade dem Lehrerberuf entflohen ist und zum „Gebrauchslyriker“ reift. Da haben sich drei gefunden. Wie Kästner wird Ohser in seinem Werk das Kind im Manne feiern und die Kindheit als zauberhaften Schutzraum der Unschuld. Die „drei Erichs“ kosten das Leipziger Studentenleben aus. Ohser, groß, übermütig, gern mit Fliege, führt das Wort im Stammcafé „Merkur“, illustriert Kästners Gedichte, eine tiefe Künstlerfreundschaft entsteht, getragen vom Geist „rebellischer Munterkeit“, wie Kästner 1957 schreibt.
1924 wird Kästner zweiter Feuilletonredakteur der „Neuen Leipziger Zeitung“ und versorgt seinen Kumpel mit Aufträgen. „Gemeinsam redigierten wir die korrekturbedürftige Menschheit.“ Kästner wird als Einziger der „drei Erichs“ den Krieg überleben, auf einem vorgetäuschten Filmdreh in Tirol. Mit leerer Kamera.
Ein Medienskandal beendet dann 1927 die Leipziger Jahre: Kästners Gedicht „Abendlied des Kammervirtuosen“ – von Ohser mit einer Dame im Negligé illustriert – erregt konservative Blätter wie die „Leipziger Neuesten Nachrichten“. Sittenwächter beklagen schäumend eine Verulkung Ludwig van Beethovens, dessen 100. Todestag man in Würde zu begehen gedachte. Kästner verliert seinen Job, alle „drei Erichs“ ziehen um nach Berlin.
Dort treibt die Berliner Künstlerboheme durch Tage und Nächte – mit Otto Dix, Werner Finck, Alfred Kerr, Kurt Tucholsky, Walter Trier, Ernst Rowohlt. Der Sachse Ohser signiert Skizzen spaßeshalber mit „Ärisch“, man genießt die Leichtigkeit des Seins. Selbst als sich der gemeinsame Bekannte Eugen Hamm das Leben nimmt, schreibt Kästner nonchalant an Ohser: „Falls Sie mal so was vorhaben, geben Sie gefälligst vorher Bescheid.“ Kästners erste Gedichtbände erscheinen, Ohser zeichnet Kritisches für die SPD-Zeitung „Vorwärts“ und andere, darunter sind böse Hitler-Karikaturen, der Nationalsozialismus hebt sein kaltes Haupt. In einer Skizze pinkelt ein Mann ein Hakenkreuz in den Schnee. „Dienst am Volk“ steht darunter.
Schon in Leipzig hat er Marigard Bantzer kennengelernt, leiser Gegenpol zum rumpeligen Bonvivant von gemütlichem Wuchs, dem freilich Ängste und Dämonen nicht fremd sind. Man urlaubt an der Ostsee, schreibt sich zärtlichste Briefe („Hast du auch bisschen Sehnsucht? Ich dolle“). Vier Tage vor Heiligabend 1931 kommt Sohn Christian zur Welt.
Er ist drei Jahre alt, als sein Vater das Angebot seines Lebens bekommt: Die „Berliner Illustrirte Zeitung“ („BIZ“) sucht eine Bildgeschichte mit „stehender Figur“, also festem Personal, nach US-Vorbild. 32 Zeichner hat „BIZ“-Redakteur Kurt Kusenberg schon vorsprechen lassen. Nichts gefällt. Ohser zeichnet einen gemütlichen Vater mit Schnauzbart, einen kleinen Sohn mit Strubbelhaar. Treffer.
Die Geschichten von der verschworenen Solidargemeinschaft Vater und Sohn, von dieser sich innig liebenden Zwei-Mann-Bande, die Ohser „über das Auge durch das Herz aufs Papier“ bringt, treffen einen Nerv. Im Advent 1934 feiern sie Premiere. Es sind Szenen der Menschlichkeit, Alltagsidyllen in kalten Zeiten, Balsam auf die Seele der ideologiemüden Deutschen. Die Verspieltheit des Paares, die runde Gemütlichkeit des kahlen Vaters und die Struwwelpetrigkeit des Sohnes, sind der Gegenpol zum zackig-schneidigen Herrenmenschen-Ideal der Nazis, zu den kulanzfreien, zwirbelbärtigen Schutzmännern der Staatsmacht.
Aber es gibt ein Problem: Ohser ist nicht Mitglied der Reichskulturkammer, hat Goebbels wegen seines tänzelnden Ganges einst als „rollendes Goebbelchen“ verspottet. Als Kästners Bücher am 10. Mai 1933 auf dem Scheiterhaufen am Berliner Opernplatz in Flammen aufgingen, brannten auch Ohsers Zeichnungen. Man erlaubt eine Ausnahme: Nur unpolitisch und unter Pseudonym darf er zeichnen. Und so wird aus Erich Ohser für eine Gebühr von 2,50 Reichsmark beim Polizeiamt Schöneberg „e.o.plauen“, der Geschichtenerzähler.
Das Publikum überschüttet ihn mit Liebe. Insgesamt 157 Geschichten erscheinen donnerstags in der „Illustrirten“, dann in drei Sammelbänden und nach dem Krieg im Südverlag in Konstanz, bei diversen Lizenznehmern und 1965 im ostdeutschen Eulenspiegel-Verlag.
„Vater und Sohn“ freilich machen auch Propaganda, ein Zugeständnis an Goebbels. Sie besuchen 1936 die Athleten im Olympischen Dorf, werben für das Winterhilfswerk, die Sächsische Landeslotterie. Vater und Sohn – aus Porzellan, Marzipan, Schokolade – sind überall: in Schaufenstern, Büchern, auf Plakaten, Keksdosen, Melitta-Kaffeefiltern, Atika-Zigaretten. Es ist zu viel. Ohser wirft hin. Vater und Sohn entschweben in der letzten Zeichnung „Abschied, oder: Das größte Abenteuer“ zum Himmel hinauf. Der Vater wird zum schnauzbärtigen Mond, der Sohn zum kleinen Stern daneben, viele Leser weinen.
Ohser hat Angst, er hat Hunderte Karikaturen gleich 1933 verbrannt, obwohl sie ja längst gedruckt waren. Er hofft, dass seine Popularität ihn schützt. Ein Trugschluss. Wieder Berufsverbot. In einem verzweifelten Versuch, sich mit den Nazis zu arrangieren, wird er 1940 zum Propagandazeichner für Goebbels’ sich konservativ-gemäßigt gebendes Renommierprojekt „Das Reich“. Scharf und böse sind die mehr als 800 Karikaturen aus dieser Zeit, gegen die Alliierten, England, Stalin. Vor sich selbst entschuldigt er sich, er sei bloß Patriot, zeichne gegen Deutschlands Feinde, nicht für die Nazis. „Seine wahre Meinung zu äußern“, schreibt er an Kusenberg, „hat keinen Zweck, weil man umgebracht wird.“ Privat aber wettert er weiter lautstark gegen Hitlers Mörderbande. Er war schwerhörig, deshalb oft weithin zu hören. Die Zerrissenheit macht ihn mürbe, die Zeichnungen werden böser, blutrünstiger.
„Ein Soldat hat es einfacher“, findet er. „Er schießt einfach, ohne besonders viel darüber nachzudenken. Aber ich muss viel denken.“ Im November 1943 wird er ausgebombt und schreibt an seine Frau, die mit Christian in Süddeutschland Zuflucht gesucht hat, es sei „unvorstellbar traurig“, durch die „Straßenleichname“ Berlins zu gehen. Marigard bettelt, Ohser möge nachkommen. Der glaubt, der Job beim „Reich“ sei seine Lebensversicherung. Das Exil kommt nicht infrage, eine Fremdsprache spricht er nicht. Die „Zensur spielt blöd“, schimpft er noch. Dann, am 28. März 1944, klingelt die Gestapo.
„Dein Vati hat aus dem Reichtum seines Gefühls abgegeben und andere reich gemacht“, schreibt ein Freund Ohsers wenig später an den 13-jährigen Christian. „Einmal wirst Du groß sein, und dann wirst Du vielleicht selbst einen Sohn haben. Dann wirst Du wissen, was für einen großen warmen Mantel aus Liebe Dein Vater um Dich geschlagen hat.“
e.o.plauen liegt auf dem Hauptfriedhof in Plauen begraben. Aber er ist nicht allein. Das Familiengrab zeigt eine Gravur von Vater und Sohn, Hand in Hand zum Himmel entschwebend.
Neben ihm liegt sein Sohn. Er starb 2001.