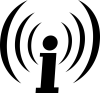Jamal ist vor Krieg und IS-Terror in Syrien geflohen. Aber auch, weil er dort als schwuler Mann nicht leben kann. In einer Dresdner Notunterkunft wurde er von anderen Flüchtlingen drangsaliert. Jetzt ist er endlich sicher.
Von Anna Hoben
Zu Hause in Syrien, sagt Jamal, gibt es zwei Möglichkeiten für Männer wie ihn: Entweder das Assad-Regime erwischt ihn, dann stecken sie ihn ins Gefängnis. Oder er fällt IS-Terroristen in die Hände, dann werfen sie ihn aus dem fünften Stock eines Hauses. Jamal, 27, sagt diese Sätze und bleibt äußerlich völlig ruhig dabei. Seine Stimme ist sanft, aber fest. Nur die Hand, mit der er die Zigarette zum Mund führt, zittert fast unmerklich. Der Übersetzerin stockt die Stimme, ihr steigen Tränen in die Augen. Das Verbrechen, um das es hier geht: Jamal ist homosexuell.
Den verrohten Kämpfern des sogenannten Islamischen Staates reichen schon äußerliche Kleinigkeiten, um ihre Brutalität zu beweisen. Ein Mann, der sich die Augenbrauen zupft, sagt Jamal, muss 40 Peitschenhiebe über sich ergehen lassen. In Syrien konnte er nicht weiterleben, also hat er sich auf die Flucht gemacht. Monate später kam er in Dresden an und wurde der Notunterkunft in einer Sporthalle der Universität auf der Nöthnitzer Straße zugewiesen. Jamal war froh und dankbar, in einem Land zu sein, in dem er nicht eingesperrt und nicht getötet wird, weil er mit einem Mann zusammen sein will.
Doch gut war es noch lange nicht. Einige Bewohner des Camps, Afghanen, Syrer, fingen an, ihn auszugrenzen und zu piesacken. Der Mann, der neben ihm schlief, sprach kein Wort mit ihm. Drei ebenfalls homosexuelle Freunde von ihm, zwei Syrer und ein Iraker, wurden in der Zeltstadt auf der Bremer Straße schikaniert. Mitflüchtlinge bewarfen sie mit Steinen, ekelten sie beim Anstehen aus der Essensschlange heraus und versperrten ihnen den Weg zur Männertoilette. „Für euch ist Platz bei den Frauen“, sagten sie.
Dass Jamal schwul ist, war den anderen Bewohnern nicht verborgen geblieben. „Die Art, wie ich spreche, ist nicht sehr männlich“, sagt er und fasst sich ans linke Ohrläppchen, an dem ein kleines, silbernes Viereck glitzert. „In Deutschland ist es normal, dass Männer Ohrringe tragen, aber bei Arabern hat das eine Bedeutung.“
Die vier Männer wandten sich an eine Dolmetscherin und schilderten ihr die Situation. Über das Netzwerk „Dresden für Alle“ kontaktierte sie den CSD-Verein, der für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen eintritt. Der Vorsitzende Ronald Zenker führte einige Telefonate, und schließlich konnten die Männer die Notunterkünfte verlassen. Seit nunmehr drei Wochen sind sie an einem Übergangsort untergebracht. Bald können sie eine Wohnung beziehen, die der Verein mit der Stadt für sie gefunden hat.
Mit Foto und richtigem Namen in der Zeitung zeigen will Jamal sich nach seinen Erlebnissen nicht. Vor allem aber hat er Sorge, dass jemand in seiner Heimat davon erfahren könnte. An einem Spätsommernachmittag sitzt er im Garten eines Lokals in der Neustadt und erzählt seine Geschichte, chronologisch, nüchtern, strukturiert. Drei Gründe habe er gehabt für seine Flucht aus Syrien: Terror des Islamischen Staates, Bürgerkrieg, Homosexualität.
Das „Todeslager“ Jarmuk
Er ist in Jarmuk aufgewachsen, einem Stadtteil von Damaskus, der aus einem Flüchtlingslager hervorgegangen ist. Dort leben die Nachkommen der Palästinenser, die 1948 nach der Gründung des Staates Israel vertrieben worden waren. Zu ihnen gehörten auch Jamals Großeltern, seine Eltern sind in Syrien geboren. Seit 2012 ist Jarmuk im syrischen Bürgerkrieg Schauplatz von Kämpfen zwischen Regierungs- und Oppositionstruppen. Zeitweise war der Ort völlig abgeriegelt, ohne Strom, Wasser und Essensvorräte. Im vergangenen April brachte dann der IS den Stadtteil unter seine Kontrolle. „Im syrischen Horror ist Jarmuk die tiefste Hölle“, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon damals. Es entwickle sich zu einem „Todeslager“.
Schon als Kind habe er gewusst, dass er schwul ist, sagt Jamal. „Ich bin so geboren und dachte nie, dass ich mich ändern muss, auch wenn ich immer gehört habe, dass das nicht normal ist.“ Nicht einmal seiner Schwester hat er davon erzählt, obwohl er sich sicher ist, dass sie entspannt reagieren würde, weil sie ein offener Mensch ist. Bei den Eltern ist er sich nicht so sicher. Er glaubt aber, dass sie es ahnen. Schließlich war da dieser junge Mann, den er oft erwähnte und der hin und wieder zu Besuch kam. Jamals Freund, seit vier Jahren. Es sei ein gutes Zeichen, dass sie ihn nie darauf angesprochen haben. „Sie haben gemerkt, dass es mir gut geht, und dass da jemand ist, den ich liebe.“ Die beiden trafen sich in der Wohnung seines Freundes. Auch in seinem Freundeskreis waren viele Homosexuelle. Sie organisierten Partys im Verborgenen. Jamal lächelt zum ersten Mal, schüchtern: „Uns gibt es überall auf der Welt, auch in Syrien.“ Von Dresden aus hat er fast täglich mit seinem Freund Kontakt, aber er weiß nicht, wie lange er die Beziehung aufrechterhalten kann, jetzt, da 3 500 Kilometer zwischen ihnen liegen. Beide waren zum Wehrdienst aufgefordert worden. Jamal ist ausgebildeter Elektrotechniker, hat aber wegen des Krieges nie in dem Beruf gearbeitet. Er konnte verweigern, weil er einen Herzfehler hat. Sein Freund musste kämpfen.
Zusammen mit seiner Schwester flieht Jamal nach Istanbul zu Verwandten. Er lernt die drei jungen, ebenfalls homosexuellen Männer aus Syrien und dem Irak kennen, die er später in Dresden wieder treffen wird. Drei Monate arbeitet er in einem Restaurant, zwölf Stunden am Tag, für einen mickrigen Lohn. Irgendwann beschließt er, weiterzureisen. Eigentlich will er zurück nach Syrien. Er telefoniert mit seinen Eltern, sie sagen: „Mach das bloß nicht.“
Seine drei Bekannten haben die Türkei schon verlassen. Jamal kratzt das Geld zusammen, das er als Tellerwäscher verdient hat. Seine Eltern verkaufen ihr Auto, schicken ihm den Erlös. Auf dem Handy zeigt er ein Foto von seiner Schwester und sich, geknipst an dem Tag, als sie sich voneinander verabschiedeten. Man sieht zwei schöne, hoffnungsvolle junge Menschen.
In Izmir findet Jamal einen Mann, der anbietet, ihn für 1 100 Dollar über das Meer nach Griechenland zu bringen. Der erste Versuch scheitert; nach der Hälfte werden sie erwischt und müssen umkehren. Beim zweiten Versuch quetscht er sich mit 13 Personen in ein Schlauchboot, zwei Meter lang, einen Meter breit. Sie starten nachts um halb zwölf. Um drei Uhr morgens geht plötzlich der Motor aus. Es ist kalt und stockdunkel. Um sie herum nichts als Wasser. Sie dürfen sich nicht bewegen, sonst geht jemand über Bord. Eine Frau hat ein etwa achtjähriges Mädchen dabei.
Irgendjemand schafft es, für kurze Zeit Handyempfang herzustellen, einen Kontakt in Griechenland anzurufen und ihm ihre GPS-Koordinaten durchzugeben. Zwei Stunden lang warten sie. Gegen fünf Uhr morgens taucht ein Boot auf. Sie schreien, pusten in Trillerpfeifen, leuchten mit ihren Handydisplays. Das Boot findet sie und bringt sie an die griechische Küste.
In dem Garten in der Neustadt kramt Jamal in seiner Tasche und zieht ein gefaltetes Papier mit seinem Namen und Passbild hervor. Er hat es bekommen, als er in Griechenland registriert wurde. Später in Serbien gab es wieder so ein Papier. Jamal legt die Blätter vor sich auf den Tisch, als wären es überlebenswichtige Dokumente.
Alles auf eine Karte gesetzt
Von Griechenland aus führt ihn der Weg über Mazedonien nach Serbien – die typische Route der Flüchtlinge. Jamal hat sich einer Gruppe von 20 Menschen angeschlossen, manchmal geht es sechs Stunden lang nur zu Fuß vorwärts. In Serbien werden sie in ein Flüchtlingslager gesteckt, das sie nicht verlassen dürfen. „Es war grauenvoll.“ Mit einem Bus fahren sie Richtung Ungarn. Wieder heißt es: marschieren, stundenlang, über Felder und Wiesen, verstecken an der Grenze, hoffen, nicht erwischt zu werden. Abends um sieben los, über die Grenze, hoffen, nicht erwischt zu werden. Angst. Aufschrecken beim kleinsten Geräusch. In der Gruppe: eine Frau mit Säugling und eine Schwangere.
Um fünf Uhr früh erreichen sie die rettende Straße. Ein Taxi bringt Jamal für 200 Euro nach Budapest. Von dort muss er den Zug nehmen, sein Geld reicht nicht mehr für einen Schleuser. Er sagt sich, dass er keine andere Wahl hat. „Ich war so weit gekommen, nun musste ich alles riskieren.“ Er fährt nach München, dann mit einem Bus nach Berlin. Er ist fix und fertig, er hat kein Geld mehr, nichts. Er stellt sich der Polizei, wird nach Dresden gebracht. Seine Schwester ist zehn Tage nach ihm in Istanbul gestartet, sie wird in München aufgegriffen. Auf dem Handy zeigt Jamal, wo sie jetzt ist: in Hessen, bei Gießen.
Seit er und die anderen drei homosexuellen Flüchtlinge die Notunterkünfte verlassen durften, haben die Mitglieder des CSD-Vereins sich um sie gekümmert. Unterstützer halfen mit Essen, Getränken, Kleidung, Zeit. Das nächste Ziel, so Ronald Zenker, sei es, in Dresden ein Haus für schwule, lesbische und transsexuelle Flüchtlinge einzurichten. Jamal sagt: „Endlich muss ich mich nicht mehr verstecken. Ich fühle mich wohl. Ich wünsche mir nur, dass Ruhe einkehrt. Und dass ich irgendwann wieder mit meiner Familie in Syrien zusammen in einem Haus leben kann.“