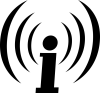Wer etwas über Derrida sagen soll, wird, wenn überhaupt, auf die Begriffe Dekonstruktion* und Poststrukturalismus zu sprechen kommen. Die meisten – und dazu dürften auch Derrida-Spezialisten gehören – wissen erst mit dem 2010 in deutscher Übersetzung erschienenen Buch „Das Tier, das ich also bin“, dass in Derridas umfangreichem Werk die Frage nach dem Tier schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat.
Jacques Derrida zu verstehen, ist außerordentlich voraussetzungsreich, zumal er sich unter anderem an Philosophen wie Martin Heidegger, Jacques Lacan oder Emanuel Lévinas orientiert, die selbst nicht zu den Leichtgewichten des philosophischen Kanons zählen. Erschwert wird der Zugang weiterhin durch Derridas eigenwilligen Stil, in fortlaufenden Argumentationen immer wieder Begriffe zu hinterfragen, darüber frei zu assoziieren und aus den gewonnenen Befunden Wortneuschöpfungen und Wortspielereien zu kreieren und die Spuren, die Begriffe in und zwischen Diskursen hinterlassen, bzw. das Nichtgesagte in dem Gemeinten offenzulegen – wodurch oft nicht ganz klar wird, was eigentlich genau seine konkrete Aussage ist. Dadurch wird aber eins gleich deutlich: Es ist die Sprache, und die Gedanken, die Sprache hervorbringen kann, aus der geschöpft wird – und nur aus ihr. Das poststrukturalistische Merkmal ist im Fehlen einer Sinnesunmittelbarkeit auszumachen. Erfahrung, Wahrheit, ja, alles, was wir sehen oder denken, ist über Text strukturiert und liegt uns nicht in direkter und häufig nicht in bewusster Form vor. Derridas Projekt besteht in nicht weniger als einer dekonstruktiven Analyse des Anthropozentrismus als einer gewaltsamen Praxis totaler Herrschaft, die mit dem Benennen von Gegenständen, von Subjekten, von Tier und Mensch ihren Ursprung nimmt.
»1997 war Derrida Teilnehmer eines
mehrtägigen Seminars über
„Das autobiographische Tier“. Dort hielt er
den Vortrag „Das Tier, das ich also bin“,
wofür er beinahe zehn Stunden brauchte«
1997
war Derrida Teilnehmer eines mehrtägigen Seminars über „Das
autobiographische Tier“. Dort hielt er den Vortrag „Das Tier, das ich
also bin“, wofür er beinahe zehn Stunden brauchte! Im Anschluss an
diesen Text veröffentlichte er 2003 „Und wenn das Tier antworten
würde?“. Diese beiden Aufsätze samt zweier unbetitelter Essays, welche
Mitschriften von Derrida-Vorträgen sind, bilden den Inhalt des Buches.
Anstoß
für seine Beschäftigung mit „dem Tier“ liefert die Katze des Franzosen,
als er nackt vor ihr steht. Es ist für ihn eine Art Schlüsselerlebnis,
um sich im Vis-à-vis, im direkten Gegenüber, sich selbst – also
autobiografisch – über das ihm Eigene, Menschliche zu befragen und die
Kreuzspuren zwischen Mensch-sein und Tier-sein aufzudecken. Die
Nacktheit vor dem Anderen spielt unmittelbar auf Emmanuel Lévinas an.
Dessen ethisches Konzept begründet sich aus der Durchdringung in diesem
Gegenüber – in der Schau des „Antlitzes“, dem Gesicht und in die Augen
Blicken. Wenn mensch sich so gegenübersteht und das „Antlitz“ sieht,
dann durchdringt sich das Andere, das Fremde als Anerkennen der
Nacktheit. Der Andere wird dadurch zu einem erkannten Gleichen – das
Gleiche ist die Verantwortung, die aus dem Schutzbedürfnis, die
Nacktheit nicht zu verletzen, erwächst. In dieser Konstellation erblickt
Lévinas das moralische Gebot: „Du sollst nicht töten.“ Was für Lévinas
nicht in Frage kam und Derrida leistet, ist, dass der Andere ein
nicht-menschliches Tier sein kann – nackt sind alle Lebewesen gleich
schutzbedürftig. Dieser Ansatz ist sehr erfrischend, weil sich (endlich)
vom Logos (also: Sprachfähigkeit, Vernunft etc.) als
Einschlusskriterium für moralische Relevanz verabschiedet wird – ohne
mit Empirie loszuargumentieren. Im Benennen nämlich, im Identifizieren
von Gegenständen (Objekte und Subjekte) „signiert“ der Mensch das
Verschwinden einer Existenz. Das Konzept des Gegenüber gibt „dem Tier“
seine individuelle Eigenweltlichkeit zurück, die für sich sein darf –
ohne dass sich mensch vorher überlegt, ob das tierliche Individuum mit
Bewusstsein ausgestattet ist, ob es intelligent ist usw. Die übliche
(anthropozentrische) Perspektivierung auf nicht-menschliche Lebewesen in
Form passiver, dem Menschen unterlegener Wesen, die von uns angesehen
werden, erfährt nun eine Wiedergutmachung – „das Tier“ wird nicht mehr
nur von uns gesehen, angeglotzt, bestaunt und als Instrument abgelesen;
es blickt uns mit gleichem Recht an! Doch wird sich zeigen, dass Derrida
seinem Unternehmen nicht gerecht wird.
So wundervoll leichtfüßig der bislang skizzierte Ansatz daherkommt – im wortlosen und damit interspeziesistisch gültigen Anerkennen der allen Lebewesen zukommenden Nacktheit bleibt der Philosoph bei der Bearbeitung der hinlänglich bekannten Frage Jeremy Benthams hängen: „Can they suffer?“ („Können sie leiden?“). Schmerzempfindung ist für Bentham Grundlage moralischer Berücksichtigung. Derrida setzt die Leidensfähigkeit sogar absolut, denn er bezeichnet sie als „das Unleugbare“. Das steht im krassen Widerspruch zu seiner kritischen Durchmusterung von Begriffsinhalten – und seiner allergischen Reaktion auf fixierte und dadurch willkürlich Grenzen festlegende Begriffe.
Das „Unleugbare“ müsste demnach ein unumstößliches oberstes Prinzip für eine neue Ethik sein, das unantastbar gültig ist – das ist jedoch pure Metaphysik! Ein Widerspruch in sich, denn es bedient die von Derrida wie die Pest gemiedene binäre Vernunftherrschaft der Menschen – im Begriff selbst ließe das „Unleugbare“ auch das „Leugbare“ zu. Es kommt gar nicht so selten vor, dass mensch behauptet, Tiere würden nicht leiden!
Ja, das Tier, was für ein Wort!
„Das Tier“ ist die Generalbezeichnung für alles, was lebt, Augen hat, fühlt, aber kein Mensch ist, um die anthropologische Differenz zwischen den Menschen und allen nicht-menschlichen Lebewesen aufrechtzuerhalten. Diese Totalität konstruiert aus der Vielfalt des Lebendigen eine simple und starre Grenzziehung und derjenige Sprecher, der von „dem Tier“ spricht, zeigt damit seine „engagierte, kontinuierliche, organisierte Teilnahme an einem veritablen Krieg der Arten“. Als Ausweg bildet Derrida ein neues Wort; das „TierWort“ (animot). Diese Wortschöpfung beschreibt er als eine Chimäre, ein antikes Fabelwesen, halb Mensch, halb Tier. Die Übersetzung von animot mit TierWort bleibt hinter dem Witz des französischen Kunstwortes weit zurück – das rhetorisch von der Homophonie, dem Gleichklang von Wörtern bei unterschiedlicher Schreibweise, lebt und damit nur als lesbare Differenz wahrgenommen wird. „Der Neologismus animot aus animal, „Tier“, und mot , „Wort“ ist als Singularwort homophon mit animaux („Tiere“), dem Plural des Substantivs animal. (…). Somit überschneiden sich hier in ein und demselben Wort animot „Tier“ und „Wort“, Schrift und Lautebene, Singular und Plural (dazu kommt die Homophonie der Schreibungen -ot und -aux für den Laut [o] im Französischen.“ (Derrida, 2010, Fn. 116). Die angestrebte Vielschichtigkeit der deutschen Übersetzung bleibt mit „TierWort“ auf der Strecke – was der Übersetzer auch zugibt. Ob sich der Originalbegriff allerdings in der alltäglichen Diskurspraxis durchzusetzen vermag, muss stark angezweifelt werden.
Derridas tierphilosophisches Programm ist als Klartext eher als tiefschürfende Inspiration zu begreifen. An einigen Stellen spricht er von der grenzenlosen Ausbeutung tierlicher Individuen – nicht aber explizit von der Notwendigkeit ihrer Befreiung. Er spricht auch von Tierrechten, nicht aber von deren Umsetzung – es fehlt die politische Dimension und die Höchstanwendung emanzipatorischer Denkleistung, die Forderung des Abolitionismus nach totaler und ersatzfreier Abschaffung von Tier(be- und ver-)nutzung.
Es ist klar, dass Derrida keine leichte Kost ist. Ein gewisser „Nerd-Faktor“ schwingt sicherlich mit bei der Beschäftigung mit dem Philosophen, zumal die Auseinandersetzung mit Lévinas und weiteren Wegbereitern des Poststrukturalismus höchstwahrscheinlich nur für Spezialist_innen spannend ist. Die originelle Herangehensweise des Franzosen allerdings, sofern mensch seine Art zu denken und zu schreiben gut findet, macht das Buch erschließenswert. Wer kann, sollte es auf Französisch lesen, um den Schwierigkeiten der Übersetzung, die durch ausführliche Kommentare und Erklärungen des Übersetzers wie eine zusätzliche Bedeutungsebene den Zugang komplizieren und den Lesefluss behindern, zu entgehen. Das verdeutlicht wiederum, dass die Sprachspielereien hauptsächlich in der Originalsprache funktionieren – und nicht ohne Verlust übersetzt werden können. Die Aussagen über das Tier-Mensch-Verhältnis sind – durch den Missgriff auf die empirische Basis einer postulierten Leidensfähigkeit – eher konventionell hinsichtlich einer sprachlich nicht haltbaren Grenzziehung zwischen den Begriffsinhalten von „Mensch“ und „Tier“. Es ist der schreibende Akt des Denkens, es ist die Anwendung von Sprache als Medium des Ausdrucks und gleichzeitigen Hinterfragens, die die Lektüre zu einem Gewinn machen können.
Tomas Cabi
*Dekonstruktion
Dieser
inflationär ge- und missbrauchte Begriff ist es wert, einmal speziell im
Sinne von Derrida erläutert zu werden. Nach Markus Wild besteht die
„dekonstruktive Arbeit […] zunächst in einer intensiven Lektüre
philosophischer, aber auch literarischer Texte, wobei in solchen
Lektüren nicht das Wichtige im Gegensatz zum Nebensächlichen im Fokus
der Aufmerksamkeit steht, sondern gerade auch das Marginale und
scheinbar Unwichtige. (…) Derrida destruiert die Überlieferung, doch was
dabei zum Vorschein kommt, erweist sich nicht als etwas Ursprüngliches,
sondern als Konstruktion. Und zwar als Konstruktion von Oppositionen
und zweitens als Konstruktion von Unmöglichkeiten.“ (Wild 2008, S.
196f.) Das ist – nach Wild – auch der Grund dafür, dass Derrida so oft
von Wortneuschöpfungen Gebrauch macht wie z. B. animot („Tierwort“).
Dekonstruktion ist so nicht primär als Destruktion (Zerstörung), sondern
als Abbau (Dekonstruktion) zu verstehen. Nachdem der Abbau vollzogen
ist, braucht es neuer Worte und Begriffe, die „kein binäres Gegenüber,
kein hierarchisches Darüber oder Darunter“ mehr haben. (Vgl. Wild 2008,
S. 202f.)
Verwendete und weiterführende Literatur:
Calarco, Matthew: Zoographies. The Question of the Animal from Heidegger to Derrida. New York: Columbia University Press 2008. [Hervorragende und umfangreiche Analyse von Derridas Tierphilosophie].
Derrida, Jacques / Rondinesco, Elisabeth: Gewalt gegen Tiere. In: Dies.: Woraus wird Morgen gemacht sein? Ein Dialog. Stuttgart: Klett Cotta 2006. S. 109-132. [Interessantes Interview mit Derrida über seine Einstellung gegenüber Tierrechten u. a.; vor allem, weil Derrida hier nicht so theoretisch/abstrakt spricht.]
Erbacher, Fabienne: Ecce Animot. Sprachliche Konstruktionen des „Tiers“. Magistraarbeit. Universität Lüneburg 2010. [Gut verständliche und aktuelle Forschungsarbeit mit Verknüpfungen in die Bereiche Gender und Speziesismus. Bleibt zu hoffen, dass es noch zu einer Buchveröffentlichung dieser Abschlussarbeit kommt.].
Steiner, Gary: „Tierrecht und die Grenzen
des Postmodernismus: Der Fall Derrida.“
In: ALTEXethik 2010.
Wild, Markus: Derrida und das „Tierwort“: Jenseits der anthropologischen Differenz? In: Ders.: Tierphilosophie zur Einführung. Hamburg: Junius 2008. S. 192-212. [Bietet einen ordentlichen Einstieg].