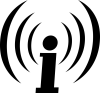Ergänzungen zur Diskussion über Aufstandsbekämpfung auf dem WarStartsHereCamp gegen das GefechtsÜbungsZentrum (GÜZ) der Bundeswehr
Beim War Starts Here Camp entstand die Idee, die dort oft nur angerissenen Diskussionen in Form öffentlicher Briefe fortzusetzen. Weniger hastig als per Email können wir so weiter zur vorgestellten Runde im Zelt sprechen, auf Gehörtes eingehen, Gesagtes präzisieren und Fäden weiterspinnen. Wenn auch nur die Hälfte der Leute, die auf dem Camp zugesagt haben einen Brief zu schreiben, es schaffen, ihre Position in Form zu bringen, könnte daraus eine spannende Geschichte werden. Ein Briefblog wird bereitgelegt, bis dahin findet ihr die Briefe auf www.bundeswehr-wegtreten.org/?q=content/camp-diskussion-0
Werte MitstreiterInnen,
Wir ergreifen hiermit die Gelegenheit, einige Fragen aufzugreifen, die im Zuge der Diskussionen zu Aufstandsbekämpfung auf dem GÜZ-Camp1 aufkamen. Zunächst wird es um das Funktionalisieren von Opfern gehen – wir möchten euch dazu einen sehr aufschlussreichen Text zum Krieg in Darfur vorstellen, der als eine Art Blaupause von Legitimierungsstrategien im Krieg gegen den Terror gelesen werden kann. Außerdem werden wir über kollektive Erinnerung reden, um das von uns geteilte Wissen über diejenigen, die sich zu unseren Feinden erheben, um ihre sich wandelnden und doch gleichzeitig altbekannten Strategien - sowie die sich ebenfalls wandelnde Wahrnehmung derselben unsererseits, die zu unterschiedlichen Einschätzungen und Konsequenzen führt. Über den einzelnen Aspekten dieses Briefes schwebt die Frage, die ein Genosse gleich zu Beginn der Freitags-Debatte an uns richtete: „Und was wollt ihr nun von UNS?“ Wir nehmen diese Frage gern auf, zeigt sie doch, dass es uns trotz aller Holprigkeit des Vortrags gelungen ist, das ins Zentrum der Betrachtung zu stellen, was unserer Ansicht nach einer der Knackpunkte ist, wenn wir den Krieg wirklich aufhalten wollen:
Eine zweigleisige Strategie zu entwickeln und durchzuhalten, die gleichzeitig mit dem Versuch, den laufenden Krieg in seiner objektiv schrecklichen Existenz zu verstehen und anzugreifen immer von unserem höchstpersönlichen wie kollektiven Leben in Kriegszeiten ausgeht. Für eine realistische Einschätzung unser Handlungsmöglichkeiten halten wir es für nötig anerkennen, was wir uns nicht ausgesucht haben: Dass wir uns überall auf der Welt im Kriegszustand befinden, auch wenn die internationale Arbeitsteilung das Leid ungleich verteilt. Dies anzuerkennen ist nicht zu verwechseln mit einem selbstgefälligen Ja zum Krieg, mit kämpferischem Pathos, der sich zwar weniger hilflos anfühlt, aber nichts desto trotz steckenbleibt in einem im Wortsinne verkehrten Verständnis unserer Situation, einer Verwechslung der Orte, an denen in unserem Leben Macht und Ohnmacht zu finden sind. Grob gesagt kann es den Herrschenden scheißegal sein, welcher Allmachtsfantasie wir uns hingeben, ob wir uns in der Pose weiser Friedenspropheten oder nihilistischer Endzeitkrieger besser gefallen. Beide erfüllen die Funktion, unseren Wunsch nach Selbstbestimmung in unerreichbare Sphären zu entrücken, während wir im Alltag bereits den kleinsten Veränderungen wie ohnmächtig gegenüberstehen.
Die Verkennung der Bereiche, in denen wir etwas bewirken können, kann als Effekt einer Operation verstanden werden, die im lautstarken Überlagern für uns wichtiger strategischer Diskussionen – unsere eigene Kraft zu erkennen und zu organisieren – mit ethisch aufgeladenen Fragen besteht, in denen wir kaum irgendwelche Entscheidungsgewalt haben. Like/Dislike Artensterben, Al Qaeda, Fukushima??? In Perspektive gelebter Autonomie stellen sich die Fragen anders. Wie es vermutlich kein Dorf gibt, das sich angesichts bleibenden Atommülls für ein AKW entscheiden würde, wird es sich eine Gesellschaft zweimal überlegen, ob sie die Folgen eines Krieges auf sich nehmen will.
Wem nutzt es, wenn wir auf eine Art und Weise diskutieren, als hinge davon, ob wir uns innerhalb oder außerhalb des Krieges definieren unsere real existierende Position im Krieg ab? Erkennen wir an, dass die Allermeisten auch in den befriedeten, reichen Staaten des Westens erneut ungefragt von ihren Eliten in den Krieg geführt wurden. Anstatt diese Tatsache in einem Schuldreflex den Opfern gegenüber auszublenden – was uns nichts kostet und ihnen nichts bringt – sollten wir uns lieber den Opferdiskurs der letzten Jahre mal genauer anschauen, der uns noch mit der Scham über die Taten unserer Armeen in die Kriegspartei des Westens einzugemeinden sucht. Nicht, dass wir es ablehnen Verantwortung zu übernehmen, etwa für unser offenkundig nicht ausreichendes Handeln gegen den Krieg. Die Frage ist, wessen Verantwortung für was. Schließlich sind wir weder Nato-Headquarter noch Verteidigungsministerium. In der regelmäßig – zuletzt im libyschen Bürgerkrieg – auch bei uns nahestehenden Leuten für Verwirrung sorgenden Diskussion, ob wir denn verantworten könnten „weiter zuzusehen“ wenn Menschen „da unten“ bombardiert werden, ob wir nicht von daher doch zähneknirschend der militärischen Intervention zustimmen müssten, ist mehr als nur eine Heuchelei der Kriegstreiber zu sehen. Zum einen organisiert diese Frage in einer Zeit, in der es mancherorts an offener Unterstützung für den Krieg mangelt, hinreichend Verunsicherung, um ihn dennoch führen zu können, zum anderen aber, und wichtiger noch, entpolitisiert der vorgeblich selbstlose Blick auf die Opfer den Krieg selbst, macht ideologisch den Weg frei für eine politische Umstrukturierung, die sich in Wortwahl, Geographie und Logik entlang alter kolonialer Linien entwickelt.
Im Buch von Mahmood Mamdani zum Darfur-Konflikt [1] haben wir eine erhellende Beschreibung dafür gefunden, wie der Opferdiskurs als Werkzeug eines neuen Paternalismus funktionieren kann. Unser Mitgefühl mit den Opfern wird auf eine Art mobilisiert, die in erster Linie auf Entmündigung zielt. Im Mittelpunkt steht nur mehr das passive, nackte Überleben der „Menschen“. Politische oder kollektive Rechte, das Recht auf Selbstbestimmung einschließlich der Legitimität, dafür persönlich zu kämpfen, stehen nicht mehr zur Debatte. Dass Frankreich in Libyen erst intervenierte, nachdem die Verträge über Öllieferungen unter Dach und Fach waren; dass ein Einsatz der NATO auch stets dazu dient, die Entwicklung eines Landes im westlichen Interesse festzulegen (Öffnung der Märkte, Strukturanpassung, Flüchtlingsmanagement), wird nicht mehr als Widerspruch zum Freiheitskampf der Aufständischen empfunden. Der Opferdiskurs löscht Autonomie als potenzielle Antwort aus, denn in herrschaftlicher Perspektive können denkbare „Akteure“ nur ordnungsgemäße Institutionen sein2; er reduziert die im Aufstand sich eröffnende Frage „Wie wollen wir leben?“ aufs Multiple-Choice-Raster „Wer soll die Bevölkerung regieren?“- und gibt sich selbst die Antwort: Leider wohl wir! Denn da der alte Staat nachweislich gescheitert ist, bleiben auf der Liste der „Schutzmächte“ nur externe Kandidaten übrig. Und wer dies als Fremdbestimmung weiter zurückweist, riskiert als egoistisch, gefühllos oder instrumentalisierend dazustehen. Dir sind die Opfer wohl egal? Dabei ist es absurd, wenn ausgerechnet die Fans militärischer Intervention den Ball mit der Behauptung zurückspielen, dass der kriegerische Prozess, der Leute zu Opfer macht für uns unbedeutend wäre. Schließlich kämpfen wir nicht zuletzt aus Empathie gegen den Krieg. Indem nun die Herrschenden vorgeben, im gleichen Interesse wie wir zu handeln – wer will „bedrohte Bevölkerungen“ nicht schützen - versuchen sie den Anschein zu erwecken, dass in Wirklichkeit sie diejenigen sind, die aus zutiefst empfundener Sorge für die Menschen die Folgen des Krieges zu lindern suchen. Ohne die Idee der Autonomie, die selbstverständlich angeborene Freiheit aller, über ihr persönliches wie kollektives Leben zu verfügen, wieder offensiv ins Spiel zu bringen, lässt sich der hermetischen Argumentation, der umfassenden Eingemeindung der Heimatfront nicht beikommen.
Doch zurück zu den Gesprächen auf dem Camp, und damit zur Frage einer Genossin, was wir uns davon versprechen, die alte Geschichte von der Aufstandsbekämpfung wieder auszugraben. Nähern wir uns der Frage im Geist einer nötigen Suche: Warum gelingt es uns nicht, den Krieg aufzuhalten, obwohl eigentlich – fast – alle dagegen sind? Ist unsere Analyse falsch oder überholt? Kennen wir unseren Feind nicht gut genug, oder nicht mehr gut genug? Einigen von Euch geht jetzt beim Wort Feind bestimmt der Hut hoch. Aber wie sollen wir diejenigen sonst nennen, die bewusst und mit aller Gewalt verhindern wollen, dass wir uns unser Leben zurückholen? Die sich gegen die Vernunft planetaren Überlebens und ohne Not zu unseren Feinden machen?3 Die Gewalt ist in der Welt – dies gilt es ebenso anzuerkennen, wie sich der Verlockung zu verweigern, daraus ein zynisches Sich-Einrichten in der Gewalt abzuleiten, den Hoody überzuziehen und sich solange cool zu fühlen im Sozialen Krieg, bis ein Messer im Bein einen daran erinnert, dass Krieg die Verhältnisse vielleicht erkennbarer, aber doch um keinen Deut besser macht.
Zurück zu Thema: Die Gefühlswallung, die sich in den letzten Zeilen Bahn gebrochen hat, ist einer gewissen Verzweiflung geschuldet (wer von euch den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ kennt...), dass wir in unseren Analysen, Kampagnen, Kritik und Praxen immer wieder gegen die gleichen Blockaden rennen, in die gleichen Fallen tappen, wahlweise eine alte Einseitigkeit gegen eine 180° gedrehte neue Einseitigkeit austauschen. Warum ist das so? Vorausgesetzt, wir suchen nicht einfach nach bequemen Ausreden, oder einer alternativen Karriere (gääähn!), stellt sich die Frage, ob wir etwas übersehen haben – in unserem Verständnis dessen, wie das System, der Feind, wir selbst, das Kampfterrain usw. zusammenhängt und in ihrem Sinne funktioniert. Warten wir nicht aufs nächste turbo-autoritäre Regime, um den Traum von einer Sache wieder mit Leben zu füllen. Dies sagen wir beileibe nicht, um Stress zu verbreiten nach dem Motto: Die Revolution ruft, um Nebenwidersprüche kümmern wir uns später! Im Gegenteil. Gerade weil wir das Privileg haben, nicht Hunger zu leiden oder im Schützengraben zu liegen, sollte es uns ein Anliegen sein, den wahrhaft unangenehmen Widersprüchen unserer Politik auf den Grund zu gehen – dabei aber, anders als so oft in den letzten Jahren nicht stehenzubleiben. Um einen greifbaren Anfang zu finden, ohne uns in modischer Selbstbespiegelung zu verlieren, schlagen wir vor, eine Idee des SPK, des Sozialistischen Patientenkollektivs aus den 1970ern aufzugreifen und unsere „Krankheit“ zur Waffe zu machen [2]. Unser Durchzogensein von Machtverhältnissen, unser Befremden uns selbst, den anderen und der Welt gegenüber zunächst festzustellen und in Ausmaß und Auswirkungen zu begreifen kann dabei nur ein erster Schritt sein. Die nächsten können nicht im immer noch besser verstehen, noch komplexer darstellen bestehen. Auch diese kleine hermetische Welt können wir erst verlassen, wenn wir einem externen Element erlauben hinzuzutreten. Nicht bloß als genealogische Komponente unserer Selbstschöpfung, sondern auch für sich genommen, nennen wir es den Rest der Welt.
Wenden wir den Blick denjenigen Personen, Strukturen und Techniken zu, die diesen Zustand der Fremdheit, Sinnlosigkeit und Leere in uns erzeugen, und die uns überdies nahelegen, uns noch in der Ruhe unseres täglichen Scheiterns wohlzufühlen. Nicht nur uns sollten wir betrachten, wenn wir an unserem miesen Zustand was ändern wollen, sondern das, was sich unserer Emanzipation entgegenstellt. An unseren Schmerz, unsere Ohnmacht, werden wir ohnehin täglich erinnert, diese Komponente geht so schnell nicht vergessen – ihr Gegenstück, jene Personen und Strukturen, die ein aktives Interesse daran haben, uns in einem passiven Modus zu halten schon eher. Schließlich legen die Leute, die weiterhin wie die Bekloppten am Erhalt des Systems arbeiten, nicht selten großen Wert auf Diskretion. Wer kennt schon die StrategInnen vom „Buchklub“ Bertelsmann? Wir schlagen vor, die Opferperspektive zu verlassen, oder vielmehr in einer gleichzeitigen Bewegung aufzuheben. In Anerkennung der Erfahrungen der Opfer kämpfen wir – gemeinsam und verschieden - gegen all jene, die sich erdreisten, andere zu Opfern zu machen. So bewahren wir als Kämpfende (nicht als abstrakte „Öffentlichkeit“, die unsere Feinde mit einschließt) die Erfahrungen der Opfer, heben sie in vielfältiger From unseren kollektiven Erinnerungen auf. Gleichzeitig aber gehen wir Beziehungen ein, versuchen eine Art von Zusammen zu kultivieren, in dem so kindischer Scheiß wie angeborene Überlegenheit bereits heute keinen Platz mehr hat. Das ist der Zauber der Parole „All power to the people!“
Trauen wir dem Bedürfnis, unsere Verstricktheit mit Herrschaft und Unterdrückung stets aufs Neue herauszustellen nicht so einfach über den Weg. Unser Vertrauen in dieses Verlangen verdeckt das enorme Misstrauen, das wir offenbar gegen uns selbst hegen. Weshalb sonst fixieren wir unsere westlichen Privilegien mit derart starrem Blick, als ob das chauvinistische Verhalten automatisch bei uns einrasten würde, sobald wir uns auch nur einen Moment den Verantwortlichen der Misere zuwenden? Dass Weiße die schwarze, Reiche die arme und Männer die weibliche Perspektive auf die Welt ignorieren können, heißt das noch lange nicht, dass sie es müssen. Die Botschaft ist eine andere: Ganz so, wie jede Fernsehsendung sagt „Bleib sitzen auf der Couch und freu dich, nichts zu tun!“, so strahlt der Minderheiten-Talk, der auf noch abgefahrenere theoretische Diskurse setzt und schließlich nicht mehr weiß, was ihn vom Gender-Mainstreaming eines beliebigen Groß-Konzerns unterscheidet, vor allem eins aus: „Es gibt keine Solidarität, kein kämpfendes Wir. Misstraue dir und den anderen - und lass die Regierung in Ruhe“. Sind wir an die vorgegebene Richtung derartig gewöhnt, dass wir die Zurichtung nicht mehr sehen?
Nehmen wir als weiteres Beispiel unsere alltägliche Teilnahme am Sicherheitsdenken. Ohne groß für Verwunderung zu sorgen gilt heute als Argument für den Abschied von der Revolution, dass man eben arbeiten muss und daher keine Zeit mehr hat. Auch hier sehen wir eine merkwürdige Umkehrung am Werk. Wir machen die Revolution nicht mehr, weil die Verhältnisse zum Kotzen sind, sondern hören deshalb damit auf. Persönlich betrachtet kann Erschöpfung freilich vollkommen nachvollziehbar sein und sollte unter GenossInnen unbedingt auf Milde stoßen. Nichts desto trotz bleibt es als Argument unlogisch und politisch nicht hinnehmbar. Was ist also faul an der Sache? Was der Opferperspektive die Überlagerung der Perspektive Autonomie ist dem Sicherheitsdiskurs das Vergessenmachen der Möglichkeit, unserer Existenzangst, Normalzustand im Kapitalismus, gemeinsam gegenüberzutreten - uns auf FreundInnen zu verlassen statt auf Geld. Erinnern sollen wir uns einzig der Fürsorge des Großen Bruders.
Auch bei dieser Operation greift der billige Trick, ein absurdes Gegenteil zu behaupten: Sobald vom Kollektiv die Rede ist, wird der Reflex aktiviert, kollektives Leben ziele darauf, das Individuum auszulöschen – was nicht nur von Natur aus unmöglich ist (ich finde das Bild sehr schön, zu versuchen, die zwei Seiten von einem Blatt Papier auseinanderzureißen) sondern auch überhaupt nicht im Interesse des Kollektivs sein kann, da der Wald bekanntlich nur so stark ist wie die Bäume, die ihn bilden. Außer einer Handvoll hirnverbrannten Stalinos wird heute niemand mehr anderes behaupten. Und dennoch: Wie oft hören wir auf größeren Treffen, dass wir keinen gemeinsamen Aufruf, keine gemeinsame Aktion brauchen, weil doch auch zu fünft ganz tolle Sachen möglich sind. Sicher doch! Das hat nie jemand in Frage gestellt! Die Abwehrhaltung kollektivem Handeln gegenüber kommt nicht daher, dass ernsthaft vertreten würde, gemeinsame Aktionen verhindern Kleingruppenaktionen am Rande des Geschehens oder in der restlichen Zeit. Es geht mehr um das Gefühl, uns vor Vereinnahmung schützen zu müssten. Woher kommt dieses Gefühl? Gibt es dafür handfeste Gründe? Wo es auf autonomen, anarchistischen, linksradikalen Treffen der letzten Jahre wirklich kaum noch Gruppen gibt, die sowas ernsthaft versuchen4. Und diejenigen, die es probieren, die Interventionistische Linke zum Beispiel, sind eigentlich argumentativ ziemlich schwach und durchsichtig in ihren Absichten. Der Vorschlag auf Gewerkschaft und Parteien zu setzen, bräuchte uns nun wirklich nicht zum Schlottern zu bringen.
Woher kommt der Reflex der Verteidigung des Individuums. Warum trauen wir unserer eigenen Organisierung nicht über den Weg, während wir dem Individuum mit seiner Geschichte und Kultur der Vereinzelung zwecks Unterwerfung weit weniger skeptisch gegenüberstehen? Einer Kultur, die nichts zu bieten hat, als uns im Einheitsbrei des Konsums mit verschiedenen Farben der gleichen Produkte zu erfreuen. Wenn wir befürchten „aufgelöst zu werden“ im Kollektiv, haben wir dann den iPodAmeisenStaat mit seiner permanenten Drohung vor Augen, sich konform zu verhalten oder rauszufliegen? Erkennen wir in der kollektiven Organisierung unter uns das Mittel, das uns die Sicherheit zum Überleben gibt, oder ist es letztlich doch Riester-Rente und Eigentumswohnung?
Was hat das nun mit Krieg zu tun? fragt ihr euch. Zugegeben fällt es nicht gerade leicht, die Fäden der subtilen, uns durchkreuzenden Zurichtung für den Krieg zu ordnen. Eben deshalb finden wir es vielversprechend, uns mit Aufstandsbekämpfung auseinanderzusetzen, weil diese von Anfang an Repression und Meinungsbildung zusammendenkt und praktisch verbindet. Es geht dabei nicht um die große Weltverschwörung, sondern um ein systemisches Funktionieren, für dessen Verständnis die Frage nach der bewussten Entscheidung und Manipulation für den Krieg allein nicht ausreicht. Es geht um sich ausbreitende Techniken militarisierten Denkens, um die Transformation unseres Lebens in Richtung Systemerhalt um jeden Preis. Social Engineering. Auf welche Weise wir diesen Umbau mit seinen bewusst-unbewussten Prozessen verstehen und demontieren können, wie es möglich wird, das oft als Regelkreis mit Feedbackschleifen dargestellte kybernetische Modell von Gesellschaft zu verlassen, könnte durch eine alte Erkenntnis des Feminismus klarer werden.
Es trug nicht wenig zum Erkennen der eigenen Stärke bei, die direkte wie die strukturelle Gewalt des Patriarchats in enger Bindung mit dem persönlichen Erleben in Beziehung, Freundeskreis, Job, usw. zu denken. Dass eine Frau, die stets zuerst an sich selbst zweifelt, die sich fragt, ob ihr Mann sie deshalb betrügt, weil sie zu alt, zu hässlich oder zu dumm ist, dass diese Frau die falsche Frage stellt. Falsch deshalb, weil es genau die Frage ist, die das Patriarchat ihr nahelegt zu stellen, damit alles bleibt, wie es ist. Weil es die Funktionsprinzipien des Patriarchats schützt, wenn die Frau mit sich selbst hadert, statt zu sehen, dass ihr persönliches Empfinden bereits gefärbt ist von patriarchalen Vorannahmen. Das eigene Gefühl nicht als behüteten Schutzraum zu denken, welches der kalt berechnenden Außenwelt gegenübersteht, sondern eben auch als Kollaborateur des Patriarchats, der eigenen Unterwerfung, ist kein leichter Schritt. Sind hingegen die Gefühle einmal ihrer scheinheiligen Unmittelbarkeit entkleidet, fällt es viel leichter, sie in die Idee vom Kampf um Befreiung aufzunehmen, was verheißt, eine alte Trennung zu überwinden und den Kampf endlich mit Herz und Verstand zu führen.
Vielleicht kann dieses Beispiel5 helfen, uns davon zu lösen, Militarisierung entweder als persönlich inszenierte Intrige der Generale und Chefs zu denken – was nicht funktionieren würde, könnten sie nicht in irgend einer Weise mit unserer Kooperation, zumindest unserem Stillhalten rechnen - oder als einen abstrakten Mechanismus, in dem es keine Handelnden mehr gibt, was derart absurd ist, dass wir nicht näher darauf eingehen. Und ist klar, dass wir die Antwort auf dieses Dilemma nicht aus dem Studium der Aufstandsbekämpfung ableiten können, war diese doch selbst Abwehrreaktion auf die revolutionäre Bewegungen. Dort, nicht in der Angst der Herrschenden vor ihnen, ist unsere Stärke zu finden. Dennoch hat uns die Auseinandersetzung mit Aufstandsbekämpfung vor Augen geführt, dass es nicht reicht, ihre repressive Seite zu bekämpfen, um die Mechanismen zu zerstören, die den Beitrag der Bevölkerung zum Fortbestand des Establishment zu sichern suchen. Auslöser der Idee für die Diskussion auf dem Camp war ein neuerer Text von CLESID, einem französischen Think Tank, der ausdrücklich davon redet, den Krieg möglichst wenig auf den Schlachtfeldern, und vielmehr bereits in der Wahrnehmung zu führen [3]. Das wollte erstmal so gar nicht zu dem Begriff passen, den wir uns von Aufstandsbekämpfung gemacht hatten, in dem es wenig anderes gab als gezielte Morde und Folter. Dass Aufstandsbekämpfung gleichzeitig Intergration ist, wie ein Militär-Handbuch aus den 1970er Jahren betont, war uns neu. Irgendwie hatten wir es nicht geschafft, diese Kenntnis über die Methoden unserer Widersacher über die Generationen zu retten. Hiermit ging zugleich vergessen, dass die Herrschenden seinerzeit tatsächlich überzeugt davon waren, es nötig zu haben, der Guerilla das Wasser abzugraben, soziale Angebote zu machen, um den Leuten weis zu machen, dass die Regierung – nicht sie selbst - am besten für sie sorgen kann. Die Erinnerung an unsere Niederlagen haben wir gut bewahrt, nicht so die Erinnerung an das zu Zeiten immer wieder äußerst reale Wissen um die Machbarkeit der Revolution.
So lasen wir Texte über Aufstandsbekämpfung und machten einige überraschende Beobachtungen.
Beginnen wir mit den Worten eines fast vergessenen Sozialdemokraten, der es weit besser als die offen reaktionären Hunde verstand, sein Gift in nachhaltiger Weise unter die Haut zu spritzen:
„Alle Veränderungstendenzen greifen auf Kleinkriegsmodelle zurück. Es wäre höchst gefährlich anzunehmen, dass der Prozess der Revolutionierung Europas nicht eingeleitet werden könnte.“ - „Es würde von einem gefährlichen Mangel an Vorstellungskraft zeugen, wenn [...] die beschriebenen Entwicklungen für ausgeschlossen gehalten würden. Als Möglichkeit und dann in ihren Entwicklungslinien vorgezeichnet müssen sie in den auf Abwehr gerichteten Überlegungen schon jetzt real existieren. Von einer solchen strategischen Sicht her erlangt die Bekämpfung des Terrorismus natürlich einen gänzlich anderen Stellenwert. Er ist ein Thema, das sich für den Staat als existenziell erweisen kann. Wenn der Terrorismus ein erstes Glied einer viel tiefer reichenden Gefahrenkette sein kann, so genügt es nicht mehr, ihn lediglich in Schach zu halten, er muss beseitigt werden.“
- Horst Herold, BKA-Chef, 1979
Aufstandsbekämpfung wurde in Kolonialkriegen entwickelt, nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Strategie ausgearbeitet und im Abstand von jeweils 20 Jahren immer wieder ins Feld geführt. Da die Bildung historischen Wissens unter uns weitgehend persönlicher Initiative und Zufall überlassen bleibt, geschieht es nicht selten, dass Ältere beim Thema Aufstandsbekämpfung abwinken „Alter Hut, ist doch eh klar“, während Jüngere aktuelle Bestrebungen zivil-militärischer Zusammenarbeit als neue Qualität einer, auf die konventionelle folgenden, vernetzten Form der Kriegführung einordnen. Ob Fatalismus oder Zukunftsangst: Letztlich trägt das Beharren, dass alles beim Alten bleibt ebenso zur Erstarrung bei wie stets aufs Neue zu beweisen, dass alles immer schlimmer wird.
Unsere Erinnerungslücke ist nicht allein unserem Unvermögen der Wissensweitergabe geschuldet, sondern ist zugleich Resultat der schmutzigen Geschichte der Aufstandsbekämpfung, die weniger erfolgreich ist, als man auf den ersten Blick denken mag. Eine Schwachstelle der Strategie liegt in der Notwendigkeit, ihren Einsatz der eigenen Bevölkerung wie der Weltöffentlichkeit gegenüber zu legitimieren. Sobald unmittelbares Schönreden unmöglich wird, geht man andere Wege: Ausbau von Kompetenzen und Umwidmen bereits bestehender Institutionen, Verschärfung der Kontrolle von Information und Kommunikation, Diffamierung der Opposition, Manipulation der Erinnerung.
Endete ein Krieg, in dem Aufstandsbekämpfung eine Rolle spielte, hatten die Kriegsherren großes Interesse daran, ihr Vorgehen zu verschleiern und herunterzuspielen (Indianerkriege), nicht mehr davon zu reden (was das Trauma Vietnam erst richtig befeuerte), und die Sache beim nächsten Mal anders zu nennen (Reagan's Low Intensity Warfare der 80er Jahre in Mittelamerika). Die vielen Namen, die der Aufstandsbekämpfung im Lauf der Zeit gegeben wurden, verweisen neben dem Bestreben, die Bevölkerung vom Sinn der Einsätze zu überzeugen (Krieg gegen den Terror, humanitäre Einsätze) auf eine Schwäche – vielmehr eine vergessene Stärke – unsererseits. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte das Establishment noch in anti-subversive, bzw. anti-revolutionäre Kriege. Das Militär nutzte diese Begriffe noch lange Zeit, während in der Öffentlichkeit längst von Terroristen, Banden, Kriminellen usw. die Rede war.
Die psychologische Operationsplanung muss erkennen:
a) Dass erfolgreiche Counterinsurgency-Operationen auf der Grundlage der Einbeziehung und Identifikation der Bevölkerung mit den Plänen und Operationen der Regierung basieren.
b) Dass die Bevölkerung auf der Grundlage dessen, was sie glaubt auch handelt – ohne Berücksichtigung der Tatsachen.
c) Dass die Aktion der Bevölkerung zur Unterstützung der Regierung nur dann entstehen wird, wenn die Leute glauben, dass sie ihre individuellen und kollektiven Ziele am Besten durch diese Regierung erreichen können.
- Counter-Insurgency Planning Guide, U.S. Army Special Warfare School, Fort Bragg
Sahen sich die Herrschenden in den 60er Jahren mit der revolutionären Gefahr konfrontiert (nach Mao und Fidel 1,2,3, viele Vietnams?) - was dazu führte, dass ein Handbuch des von Kennedy neu geschaffenen Ausbildungszentrum für Counterinsurgency sich fast zur Hälfte mit der Vereitelung der Revolution durch (gefühlte) Sozialreformen befasst - so war die kommunistische Bedrohung, die Reagan in den 80ern am Werk sah, schon derart zu einem Produkt von Paranoia & Propaganda Ltd. geworden, dass man sich nicht mehr die Mühe machte, Programme auch nur scheinbar in die Tat umzusetzen, „die Leute beeindrucken mit der Fähigkeit und Entschlossenheit der Regierung, ihren Bürgern zu helfen, ein besseres Leben zu erhalten“ [4]. Die Eckpunkte der Counterinsurgency dieser Zeit sind rein militärische: „Preventive Medicine – Urban Insurgency – Rapid Deployment – Massive Firepower“ [5].6 Es ist vor allem diese Form, die unsere Erinnerung prägt: Massaker an ZivilistInnen durch die Contras in Nicaragua, Politik der verbrannten Erde in Guatemala, CIA, Folter. Der in dieser Zeit vernachlässigte konstruktive Moment des Einwirkens auf die Bevölkerung kehrt heute in neuem Kleid zurück.
Das militärische Scheitern in Irak und Afghhanistan führte zu einer Rückbesinnung auf das Konzept Aufstandsbekämpfung und zum Aufwallen eines Richtungsstreits innerhalb der Streitkräfte darüber, wie mit der sich ändernden Form des Krieges umzugehen sei, und was diese Veränderung überhaupt ausmacht: Werden kommende Kriege hochgerüstete High-Tech-Auseinandersetzungen oder Kriege der vierten Generation in Tradition der Guerilla sein (4GW) - die, nicht zuletzt in Anbetracht der militärischen Übermacht ihrer Feinde, in erster Linie an der politischen Front ausgefochten und gewonnen werden. Fest steht, dass sich dieser Streit einzig um das beste Mischungsverhältnis aus dem seit jeher rein taktischen (!) Kampfes um die Herzen und Köpfe und dem Einsatz militärischer Gewalt dreht – dass die beiden sich notwendig ergänzen steht für Militärs allerseits außer Frage.
Die Ausbeutbarkeit der Dritten Welt mit der Stabilität der westlichen Industriestaaten zu verbinden – das ist das Idealbild einer erfolgreichen Counterinsurgency-Kampagne.
- Jochen Hippler, Krieg im Frieden
Nach dem Zweiten Weltkrieg zielte Counter-Insurgency mit allen zivilen wie militärischen Mitteln auf das Roll-Back der kommunistischen Bedrohung. Ihr konstruktives Moment, das heute in der Schaffung einer passiven, sich selbst freudig im Containment haltenden Bevölkerung besteht, ist die Weiterführung der Idee, der Guerilla die Unterstützung zu entziehen wie den Fischen das Wasser. Bereits die Art, wie wir uns in der Gesellschaft wahrnehmen, wie sehr wir die Trennung von Fisch und Wasser verinnerlicht haben - uns entweder als hilflose Fische fühlen oder über das Wasser nachdenken, die anderen, die Bevölkerung im Visier - zeugt von Jahrzehnten präventiver Counter-Insurgency, vom nicht mehr in Betracht ziehen der Revolution. Wir können unsere Strategie nicht aus dem ableiten, wie gegen uns vorgegangen wird. Denn genau das, was wir dem Bestehenden voraus haben, soll ja neutralisiert, oder, wo das nicht geht, simuliert werden. Die Idee von einem besseren, einem guten Leben ohne Schweinesystem!
Innerhalb der US-Armee wird die Diskussion über die Feinde des Westens rein technisch geführt. An der zu bekämpfenden Idee interessieren nur ihre Auswirkungen. Die letztlich den Krieg politisch entscheidende Stärke der sozialen Basisprojekte der Ersten Intifada bzw. der Hizbollah wird analysiert, ohne deren politische Perspektive auch nur zu erwähnen. Es sei „unvermeidbar, dass diverse Gruppen überall auf der Welt zurückbleiben, während die Welt zur Ökonomie der Informations-Ära voranschreitet“ [7]. Ende Aus. Der Rahmen ist als alternativlos gesetzt, welches andere Ziel als westliche Werte und Verwertung könnte es auch geben? Dass das Establishment sich im Moment nicht gezwungen sieht, irgendwelche Pseudo-Alternativen anzubieten, kann als Erfolg früherer Counterinsurgency-Kampagnen gewertet werden. Oder als Schwäche der Bewegungen: Warum gab es in Folge des Arabischen Frühlings kaum ein praktisches Sich-Wiedererkennen in Europa? Warum verhalten wir uns ruhig, obwohl die Zustände, die in den 1970er Jahren alle Welt in Aufruhr versetzte, nicht besser geworden sind? Im Krieg gegen Mensch und Natur tritt in allen Bereichen heute das real ein, was damals als kommender Schrecken an die Wand gemalt wurde. Vielleicht sind wir weder schlauer, noch desillusionierter als die alten GenossInnen, sondern einfach befriedet?
Kein X für ein U
Unser Anliegen ist es nicht, herumzumäkeln, weder an uns noch an den Verhältnissen. Wir erhoffen uns von einer Diskussion um Aufstandsbekämpfung ein Stück Klarheit über unsere Situation, um zurück zu finden zu einer Perspektive des Kampfes um Befreiung – den wir nicht weniger nötig haben als Leute im globalen Süden, Iran oder Russland. Indem wir im staatlichen Angriff nicht nur Repression, die bewusste Unterdrückung innerer und sonstiger Feinde sehen, sondern ergänzend die konstruktive Komponente – das Sich-Ergänzen von Eier zerschlagen und Omelette backen - könnte es nebenbei gelingen, zu verstehen, was es mit jener eigentümlichen Lähmung auf sich hat, die noch unsere Kritik zu Bekenntnissen gerinnen lässt. Das Konstruktive der Aufstandsbekämpfung besteht heute – am Ende der Geschichte des Fortschritts (und seiner falschen Versprechungen) - darin, uns glauben zu lassen, dass wir keinen Einfluss auf die Wirklichkeit haben. Dass wir unsere Perspektive nicht ändern können, selbst wenn das existierende System keine mehr anbietet. Ob wir das einfach glauben oder hochgelehrt herleiten, ob wir aus Gleichgültigkeit nichts anderes versuchen, aus Angst vor Vereinnahmung oder aufgrund militärischer Übermacht ist aus Sicht der Aufstandsbekämpfung egal. Was zählt ist der Effekt. Ohne die Vorstellung von einer autonomen Perspektive bleiben unsere Linienstreits, so radikal sie in Theorie oder Praxis auch sein mögen, anschlussfähig an ihre Second-Life-Strategie: Eine Zusammenleben zu konstruieren, das als Anpassungskreis funktioniert, insofern wir es als selbstverständlich erachten, auf den Staat als Mittler notwendig angewiesen zu sein. Insofern unsere Erinnerung nicht von unserer Unterwerfung erzählt, der Zerstörung nicht konformer Solidaritäten und kollektiver Unabhängigkeiten, der äußerst gewaltsamen Herstellung individueller Erpressbarkeit als Grundlage des folgenden Wiederauffüllens mit Gütern und Dienstleistungen. Realitätskontrolle.
Und doch muss noch ihre weiße Lüge sich aus dieser Welt speisen, auf der echten Welt aufbauen, denn eine andere gibt es nicht! Was Autonomie bedeutet, ist das Festhalten an anderen Perspektiven auf die Welt und folglich die Verteidigung anderer Praxen. Was uns zunächst eint, ist die Ablehnung des bescheuerten Monopols auf das Leben, mit dem wir uns heute konfrontiert sehen. Der Rest – Kooperation, Separation, Krieg – wird dann zwischen denen zur Diskussion stehen, die es betrifft. Wir haben nicht vor, ihr abstraktes Modell durch ein anderes zu ersetzen - und uns in Folge mal wieder solange zu streiten und gegenseitig zu töten, bis nur noch ein Vorschlag übrig ist. Autonomie heißt fürs Erste, ihren hermetischen Scheiß zu beenden, anzuhalten, durchzuatmen und die Tür aufzustoßen. Frohen Herzens, voll und ganz auf unser eigenes Risiko. Do the real thing!
Die von der Freitagsdiskussion, Januar 2013
Es wäre schön, Resonanz auf diesen Brief zu bekommen. Wir haben damit versucht, einige weniger augenfällige Aspekte genauer unter die Lupe zu nehmen, die unserer Ansicht nach von Operationen der Aufstandsbekämpfung berührt werden, im Sinne einer präventiven Zurichtung für den Krieg, auf dass niemand in diesen täglich absurder werdenden Zeiten plötzlich auf die Idee kommt, sich des Empires zu entledigen. Zu Wahrnehmung, Bewusstsein und Erinnerung gibt es jede Menge zu diskutieren: Die Rolle der Medien als Kitt der Gesellschaft, einer Bildung, die aufs Hervorbringen von Funktionseliten und AnwenderInnen reduziert ist, die Förderung eines schematischen Denkens à la PowerPoint, das nur mehr auf Vollständigkeit der Aufzählung und Treue zur Aufgabenstellung prüft. Nicht zuletzt die Wiedergeburt eines Menschenbildes potentieller Mörder, die paradoxerweise einzig der Staat bändigen kann, soll die Welt nicht im Chaos versinken. Der Bock als Gärtner...
Weiter die Frage, inwieweit es im Rahmen unseres Briefwechsels interessant sein kann, über die im Militär diskutierten Richtungsentscheidungen und strukturellen Veränderungen zu reden, etwa die Transformation der Bundeswehr oder die Debatte um den Krieg der Vierten Generation in der US-Armee. Was könnte unser politisches Interesse einer solchen Untersuchung sein? Welche Fragen haben wir an den Ausbau und das Zusammenwachsen der europäischen „Sicherheitskräfte“? Gegen wen wird hier eigentlich eine Sicherheitsarchitektur errichtet?
Erwähnte Quellen
[1] Mahmood Mamdani. Blinde Retter: Über Darfur, Geopolitik und den Krieg gegen den Terror. Hamburg 2011.
[2] SPK. Aus der Krankheit eine Waffe machen. Agitationsschrift des Sozialistischen Patientenkollektivs an der Universität Heidelberg. Trinkont, München 1972.
[3] Laurent Danet. „La Polémosphère“. Sécurité Globale # 10. Dossier Contre-Insurrection(s). Centre Lyonnais d'Études en Sécurité et Défense (CLESID), 2010.
[4] U.S. Army Special Warfare Planning School, Fort Bragg. Counterinsurgency Planning Guide. (In deutscher Übersetzung in der „Reihe Internationale Kritik“ erschienen. Ohne Datum)
[5] Michael T. Klare. Fighting the Next Wars: The New Counterinsurgency. In „The Nation“ vom 14. März 1981. (Auf deutsch im gleichen Heft der „Reihe Internationale Kritik“)
[6] Jochen Hippler. Krieg im Frieden: Amerikanische Strategien für die Dritte Welt. Köln 1986. (Gutes Résumé der US-amerikanischen Counterinsurgency Kampagnen der 60er und 80er Jahre)
[7] Thomas X. Hammes. The Sling and the Stone: On War in the 21st Century. St. Paul, Minnesota: 2004
Weitere Bücher & Texte
Selahattin Çelik. Die Todesmaschine: Türkische Konterguerilla. Köln 1995.
Katja Diefenbach. „Just War: Neue Formen des Krieges. Polizeirecht, Lager, Ausnahmezustand“. In: World at War: Militarisierung, Kolonialismus, Neue Kriege. alaska materialien, 2001.
„Einstellungsantrag der Verteidigung zum Verfahren gegen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt vor dem OLG Stuttgart 1984“ In: Janssen & Schubert. Staatssicherheit: Die Bekämpfung des politischen Feindes. (behandelt Terrorismusbekämpfung als Teil internationaler militärischer Aufstandsbekämpfung - Hat uns nachdenken lassen über die Defizite unserer kollektiven Erinnerung).
Frantz Fanon. Die Verdammten dieser Erde. [1961] Hamburg 1969 (nach wie vor erhellend, nicht zuletzt was die im kolonialen Labor erprobten präventiven Regierungstechniken betrifft)
David Galula. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Praeger Publishers, 2006.
Detlef Hartmann. „Die Knarre in der einen Hand, den Bleistift in der anderen“. In: Failing Sciences, Embedded Stakeholders: Wider den SFB 700. Berlin 2009. (Der an der FU stationierte Think Tank forscht zu „Governance in Räumen begrenzter Staatlichkeit“ - http://materialien.org/texte/hartmann/700-2-2.pdf)
Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V. „Die UN und der neue Militarismus“ Tübingen 2011. (Viele gute Artikel und Analysen zum Thema, u.a. in der imi-Zeitschrift „Ausdruck“ - http://www.imi-online.de
Jan Koehler und Christoph Zuercher. Quick Impact Projects im Nordost-Afghanistan: Eine Studie im Auftrag des BMVg. 2007 (Zwei vom SFB 700 zu „schnell umsetzbaren, sichtbaren Maßnahmen mit schneller Wirkung im Sinne einer verbesserten Zielgruppenakzeptanz“)
Gregory Kreuder. Sharpening the Needle: Non-Lethal Air Power for Joint Urban Operations 2020. Air Command Staff College/Air University. Maxwell Air Force Base, Alabama: 2008 (Passt nicht ganz, aber da öfter GenossInnen nach der Quellenangabe fragten...)
Mathieu Rigouste. L'ennemi intérieur: La généalogie coloniale et militaire de l'ordre sécuritaire dans la France contemporaine. La Découverte, Paris 2009.
Wolfgang Rüddenklau. Störenfried: DDR-Opposition 1986-1989. Berlin 1992 (berichtet u.a. über die alltäglichen Methoden der Stasi. Geschrieben kurz nach der bislang einzigen populären Erstürmung eines Geheimdienst- Archivs in der deutschen Geschichte)
Unidentified anarchist publishing COINTELPRO – The Danger We Face. 2009 (online auf http://anti-politics.net
Aus dem Schlusskapitel von Mahmood Mamdanis Buch
Wir zitieren den Gedankengang aus Blinde Retter: Über Darfur, Geopolitik und den Krieg gegen den Terror hier ausführlich, auch wenn unsere Perspektive nicht auf den politischen Rechte von StaatsbürgerInnen aufbauen kann, da wir der Ansicht sind, dass es in der Logik staatlich gewährter Rechte liegt, mit der implizit enthaltenen Drohung zu regieren, diese Rechte wieder nehmen zu können. Dennoch hat uns der Text weit über den geschilderten Kontext hinaus zu denken gegeben:
„Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bestand die internationale Ordnung aus zwei ungleichen Teilen, einem privilegierten und einem unterdrückten: dem System souveräner Staaten in der westlichen Hemisphäre auf der einen Seite und dem Kolonialsystem in weiten Teilen Afrikas, Asiens und des Nahen und Mittleren Ostens auf der anderen Seite. Im Zuge der Entkolonialisierung in der Nachkriegszeit wurden die ehemaligen Kolonien als Staaten anerkannt. Damit wurde der Geltungsbereich des für die zwischenstaatlichen Beziehungen zentralen Souveränitätsgrundsatzes auf die ganze Welt ausgedehnt. Mit dem Ende des Kalten Krieges kam es zu einem weiteren grundlegenden Wandel. Es war dies der Vorbote einer „humanitären Weltordnung“, die die Souveränität von Staaten zu relativieren verspricht, sollten diese dem internationalen Menschenrechtsstandart nicht genügen. Viele glauben, dass wir, was die internationalen Beziehungen anbelangt, mitten in einem Systemumbruch stecken. Verhängnisvollerweise wird der bisherige Bezugsrahmen für Verantwortlichkeit – das Völkerrecht – zugunsten einzelner Rechte verworfen. Wie die Bush-Regierung bei ihrem Einmarsch in den Irak unmissverständlich klargemacht hat, braucht man sich bei einer „humanitären Intervention“ nicht um geltendes Recht zu scheren. Vielmehr zeichnet sich eine solche Intervention ja gerade dadurch aus, dass sie über dem Gesetz steht. Deshalb ist die „humanitäre Intervention“ auch das passende Pendant zum „Krieg gegen den Terror“.
Diese neue Weltordnung, offiziell auf dem UNO-Weltgipfel im Jahr 2005 angenommen, macht es sich zur Aufgabe, „gefährdete Bevölkerungen“ zu beschützen. Verantwortlich zeichnet die „internationale Gemeinschaft“, wobei in der Praxis die Vereinten Nationen diese Aufgabe übernehmen würden und insbesondere der Sicherheitsrat gefordert sei, dessen ständige Mitglieder die Großmächte sind. Sanktioniert wird diese neue Weltordnung mit Worten, die deutlich vom früheren Sprachgebrauch abweichen. Da ist nicht mehr von Völkerrecht und von staatsbürgerlichen Rechten die Rede. Als „Menschen“ werden die zu schützenden Bevölkerungen bezeichnet; die Krise, die sie durchmachen, die Intervention, die zu ihrer Rettung unternommen werden soll, und schließlich die Institutionen, die die Intervention durchzuführen gedenken werden allesamt mit dem Etikett „humanitär“ versehen. […] Bei näherer und kritischer Betrachtung zeigt sich, dass der Umbruch, den wir heute erleben, kein vollständiger, sondern nur ein teilweiser ist. Der Übergang vom alten Souveränitätssystem zur neuen „humanitären Weltordnung“ beschränkt sich auf Gebilde, die als „gescheiterte Staaten“ oder als „Schurkenstaaten“ bezeichnet werden. Wir haben es also wieder mit einem zweigeteilten System zu tun: In einem Großteil der Welt wird die Staatensouveränität nach wie vor geachtet; aufgehoben wird sie indes in immer mehr Ländern Afrikas und des Nahen und Mittleren Ostens.
Das seit dem Westphälischen Frieden anerkannte Prizip – die staatliche Souveränität - diese Münze ist im internationalen System nach wie vor im Umlauf. Man sehe sich aber beide Seiten dieser Münze an: Souveränität und Staatsbürgerschaft. […] Der Diskurs über „humanitäre Intervention“ wurde vom Diskurs über Bürgerrechte losgelöst. Insofern als die „humanitäre Weltordnung“ vorgibt, für Rechte einzutreten, geht es um die verbliebenen Rechte eines Menschen, nicht um die ganze Bandbreite der Rechte eines Staatsbürgers. Während die Rechte des Staatsbürgers überaus politisch sind, betreffen die Rechte des Menschen nur sein nacktes Überleben – mit einem Wort: seinen Schutz. Da ist nicht mehr von Rechteinhabern die Rede, die selbst darauf hinarbeiten, sich von ihrem Joch zu befreien, sondern von passiven Nutznießern einer vom Ausland übernommenen „Schutzverantwortung“. Wer der „humanitären Ordnung“ unterworfen wird, gleicht eher einem Almosenempfänger als einem Staatsbürger mit Rechtsansprüchen. Dem Humanitarismus geht es erklärtermaßen nur um den Erhalt von Menschenleben, nicht um die Förderung eigenverantwortlichen Handelns. Gefördert wird nur die Abhängigkeit. Der Humanitarismus markiert den Beginn eines Treuhandsystems.“ [285 ff]
Weiter geht es um die Rolle der NGOs, deren Kriegs-Ökonomie. Es tun sich einige Parallelen zur Politik in sogenannten Problemvierteln auf. Hier wie dort liegt es im Interesse der NGO-ArbeiterInnen, dass ihre Mündel auch in Zukunft ihrer Fürsorge bedürfen, ihr Einkommen hängt vom Andauern der schlechten Situation ab. Umgekehrt produziert die so gepflegte Abhängigkeit das Bedürfnis nach Hilfe von außen, erschafft so selbst ihr Subjekt:
„Das alles war so unglaublich, dass ich kaum meinen Augen und Ohren traute, aber die externe Intervention hatte tatsächlich einen internen Akteur hervorgebracht: die nach Rettung verlangenden Binnenvertriebenen. Sie klammerten sich verzweifelt an ihre Hoffnung auf eine andere Welt und blieben gegenüber der Politik dieser Welt arglos. Angesichts der Tatsache, dass die Binnenvertriebenen im Chor nach einer nichtafrikanischen Intervention riefen, gab der AU-Vermittler Salim Ahmed Salim zu bedenken, dass eine externe Intervention nur dann Aussicht auf Erfolg hätte, wenn sie einen internen Prozess unterstützte und nicht als Ersatz für einen solchen wahrgenommen würde. […] Er wollte die Darfuris davor warnen, all ihre Hoffnungen auf eine externe Intervention zu setzen, weil dies einem Verzicht auf jegliche Eigenverantwortung gleichkäme. Doch stand er mit dieser Auffassung ziemlich allein da.
Anstatt nun die von den Binnenvertriebenen vertretene Ansicht als eine Art „falsches Bewusstsein“ abzutun, sollten wir uns lieber fragen, von welcher Warte aus diese Ansicht einen Sinn ergibt. Wie einige darfurische Sozialarbeiter erkannt zu haben schienen, machte sich unter den Binnenvertriebenen eine „Verbrauchermentalität“ breit. Der Verbraucher bildet in diesem Fall das Gegenstück zum Staatsbürger. Je mehr der Staatsbürger in den Hintergrund rückt, desto mehr tritt der Verbraucher in den Vordergrund. In diesem Sinne ist die Verbrauchermentalität sowohl Schlüsselelement als auch wichtiges Produkt des „humanitären“ Interventionismus.“ [309]
1GÜZ steht für das international genutzte, High-Tech GefechtsÜbungsZentrum der Bundeswehr, zwei Stunden westlich von Berlin gelegen. Mehr Infos zum GÜZ, dem War Starts Here Camp vom September 2012 und den Aufruf in mehreren Sprachen gibt’s auf http://warstartsherecamp.org
2Ein faszienierender Trick, um „gemeine“ Frauen und Männer als Handelnde - schwuppdiwupp - verschwinden zu lassen. Funktioniert im Nachkriegs-Protektorat nicht anders als in der Zivilgesellschaft, achtet mal drauf.
3Warum wir denken, dass wir uns mit der Utopie einer gewaltfreien Welt (eine Vorstellung die, wie kann es anders sein, einer extrem gewalttätigen Welt entspringt) in die Tasche lügen, warum ein Bann der Gewalt vielleicht eine andere Welt hervorbringen kann, aber keine weniger gewalttätige, könnte Thema eines weiteren Briefes sein. Eine aufrichtige Auseinandersetzung mit nicht auf staatliche Lösungen zielenden PazifistInnen wäre uns ein Vergnügen. Nicht zuletzt, weil dadurch (wieder) klarer werden könnte, was eine emanzipative pazifistische Argumentation von den sich zunehmend professionalisierenden Strategien der Gewaltfreiheit in NGO-Kreisen unterscheidet, die sich den Herrschenden nicht zuletzt im Krieg mit BeraterInnenteams und Methodenlehrgängen andient.
4Für die meisten von uns ist es selbstverständliche Basis der Begegnung, diese Form der Organisierung nicht richtig zu finden. Vergessen wir nicht, dass die Autonomen entstanden, als sie der dogmatischen Politk der K-Gruppen den Rücken zukehrten. Dachten da einige, schon aus der Gegenüberstellung allein würde sich – quasi automatisch - eine andere Praxis ergeben? Oder warum reagieren wir oft so hilflos auf die Kritik, noch einiges an verkorkstem Orga-Erbe mit uns herumzuschleppen? Wozu nicht zuletzt der Glaube an den Neuen Menschen gehört.
5Wir wissen leider nicht, auf welche Theoretikerinnen sich diese Bresche im Denken in den 70ern stützte. Wenn sich welche daran erinnern (und nicht nur wie wir seinerzeit praktisch darin unterrichtet wurden) könntet ihr unser aller Dekolonisierung einen großen Gefallen damit tun, diese Texte wieder in die Diskussion zu bringen oder für die aktuelle Situation neu zu formulieren. Bitte!
6In Betonung der allgemeinen Tendenz verbannen wir in die Fußnote, dass es natürlich auch in den 80ern Versuche gab, die Bevölkerung zu kaufen. Wie Thomas O. Enders (State Department) es für El Salvador sagte: „Niemand zweifelt daran, dass landbesitzende Bauern ein starkes Bollwerk gegen die marxistisch-leninistische Bedrohung sein werden. Es gibt keine andere Wahl, wenn wir ein wirtschaftliches und soziales Chaos und einen schließlichen Sieg der Guerillas verhindern wollen.“ (zitiert in Hippler 1986)