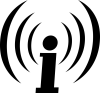Alter, Augen-, Haar- und Hautfarbe? Das DNA-Profiling soll in Deutschland bei Straftaten ausgeweitet werden. Der Gesetzentwurf stößt auf Kritik.
von Sonja Kastilan
Vergewaltigt und getötet: Der Mord an einer 19-jährigen Studentin in Freiburg hat im Herbst bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein aus Afghanistan stammender junger Mann wird der Tat verdächtigt und sitzt in Haft. Ein Haar am Tatort und Videoaufnahmen aus der Tatnacht führten die Ermittler auf seine Spur.
Aus biologischem Fundmaterial dürfen Forensiker in Deutschland bisher nur das Geschlecht der Person herauslesen, von der es stammte, und eine Art genetischen Fingerabdruck bestimmen – an Stellen im Erbgut, die als „nicht codierend“ gelten, also keine Informationen etwa über das Aussehen liefern. Und das soll sich ändern: Der Justizminister des Landes Baden-Württemberg, Guido Wolf, hat beim Bundesrat den „Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Umfangs der Untersuchungen von DNA-fähigem Material“ eingereicht. Abgesehen vom Geschlecht, sollen aus Tatortspuren in Zukunft auch das biologische Alter sowie äußerliche Merkmale abgefragt werden dürfen: Augen-, Haar- und Hautfarbe. In Bayern wünscht man sich, außerdem die biogeographische Herkunft eines Menschen ermitteln zu können.
Um sich jetzt über die Möglichkeiten der genetischen Methoden, aber auch ihre Grenzen und Risiken zu informieren, hatte das Bundesjustizministerium am vergangenen Dienstag Experten zur Anhörung nach Berlin geladen, darunter die Politologin Barbara Prainsack, Professorin am Kings’s College in London.
Die Politologin Barbara Prainsack hat am King‘s College in London einen Lehrstuhl für Soziologie inne und ist Mitglied der Bioethikkommission in Österreich und der britischen National DNA Database Ethics Group.
Frau Prainsack, was führte Sie nun als Sozialwissenschaftlerin nach Berlin?
Ich beschäftige mich seit fünfzehn Jahren intensiv mit der Regulierung und den ethischen Aspekten von DNA-Tests, und zwar sowohl im medizinischen Bereich als auch in der Forensik. So berate ich zum Beispiel als Mitglied der Ethikgruppe der Nationalen DNA-Datenbank in Großbritannien, wie mit genetischen und biometrischen Datensätzen umzugehen ist. Diese Ethikgruppe wurde auch deshalb eingesetzt, weil in der Öffentlichkeit große Sorge bestand, dass die Polizei Zugriff auf private Daten hat. Wir beraten in Fragen der Nutzung und Speicherung sowie zur Einführung neuer Technologien für die Forensik. Und ich möchte darauf hinweisen, dass in vielen Ländern zwar geregelt ist, was in DNA–Datenbanken gespeichert werden darf, aber nicht, welche konkreten Informationen man in einem konkreten Fall aus DNA-Spuren herauslesen darf. So wie man auch Zeugen alles fragen darf.
Das heißt, britische Ermittler könnten phänotypische Merkmale bestimmen lassen, wie es in den Niederlanden in Einzelfällen, etwa bei Mord oder Sexualdelikten, geschieht?
In der Ermittlungsarbeit darf man viele Medien vieles fragen: Zeugen, Überwachungskameras; in den Vereinigten Staaten wurden schon Home-Assistenzsysteme ausgewertet. In Großbritannien könnte man in bestimmten Fällen die DNA entsprechend auslesen und etwa die Abstammungslinien ermitteln – Daten zum Y-Chromosom dürften sogar gespeichert werden, nicht zentral, sondern in einer eigenen Datenbank. Auf Analysen zur Hautpigmentierung wurde bisher allerdings verzichtet, weil die Methoden noch nicht so weit waren. Aber das käme sowieso nur in sehr wenigen Fällen überhaupt in Frage.
Weil diese spezielle Analyse teuer und aufwendig wäre?
Ja, und weil es nur selten sinnvoll wäre. Ich brauche von einer Spur nicht die Hautfarbe zu ermitteln, wenn das herkömmliche DNA-Profilmuster genügt, um einen unter fünf Verdächtigen zu finden oder um einen Abgleich mit der Datenbank zu machen.
Würden Sie das DNA-Profiling als sinnlos bezeichnen?
Das ist es keineswegs. Im Prinzip bin ich eine Befürworterin der Ausweitung der DNA-Analyse – womit ich nicht zugleich die Speicherung meine –, wenn ihre Methoden zur Unterstützung der Ermittlungsarbeit in bestimmten Fällen eingesetzt werden. Wenn es sich zum Beispiel um eine schwere Straftat handelt, an deren Aufklärung die Öffentlichkeit großes Interesse hat, so dass der Einsatz der dafür nötigen öffentlichen Gelder und Ressourcen gerechtfertigt ist. In Fällen, in denen es keinerlei Hinweise auf den Täter gibt und die klassischen Methoden ins Leere laufen. Oder zur Identifizierung stark entstellter Leichen, wie es heute schon teilweise erlaubt ist, um die Suche in der Gruppe der Vermissten einzuschränken.
Der Gesetzentwurf wird kritisiert, er wirke wie mit der heißen Nadel gestrickt. Was halten Sie davon?
Auch ich bin davon nicht überzeugt. Im bisherigen Entwurf legt man sich auf Geschlecht, Alter, Augen, Haut und Haar fest, das ergibt wenig Sinn. Stattdessen sollte man eher formulieren, dass entsprechend getestete Methoden erlaubt sein sollen, die Hinweise auf äußerliche Merkmale geben können. Diese Methoden können ja nur helfen, nicht vorhersagen; auch könnten manche in Zukunft verbessert werden, was dann vielleicht für eine Wahl zusätzlicher Merkmale sprechen würde. Es liest sich außerdem, als ließe sich mit diesen Verfahren die Kriminalität bekämpfen, insbesondere von bestimmten Gruppen, was nicht der richtige Gedanke als Grundlage wäre. Aber ich würde mir nicht nur eine andere Formulierung wünschen, sondern dass der ganze Vorgang zeitlich und inhaltlich vom Freiburger Mordfall entkoppelt wird, der zum Anlass genommen wurde.
Zumal die Genanalysen keine klaren Antworten liefern, kein Schwarz oder Weiß, sondern Wahrscheinlichkeiten. Weder alle Haar- noch alle Augenfarben können derzeit genau bestimmt werden. Die Gutachter argumentieren mit Prozenten ...
In der Tat erhält man durch DNA-Profiling kein gutes Phantombild. Es gibt auch keinen Gentest für „Rasse“, nur regionale Cluster sind erkennbar, und am sichersten ist die kontinentale Herkunft. Daher müsste man dringend davon abraten, womöglich Reihenuntersuchungen anzuordnen, wenn der Verdacht auf eine Person fällt, die beispielsweise zu 80 Prozent braunhaarig ist und zu 90 Prozent dunkle Augen hat. Das könnte Rassismus schüren und wäre wissenschaftlich und ethisch problematisch. Wenn man jetzt Genanalysen in Deutschland etablieren möchte, sollte man vorsichtig agieren, denn es herrschen starke Strömungen, die äußerliche Unterschiede eben nicht als Varianz ansehen, sondern Menschen danach bewerten.
Das Argument der Diskriminierung wiegt schwer, wenn es um die Ausweitung der DNA-Analysen geht. Es wird ja zunächst kein Individuum identifiziert, sondern eher eine Gruppe beschrieben. Wie ließe sich eine Ausgrenzung verhindern?
Da es ja nur wenige Fälle sein dürften, in denen äußerliche Merkmale untersucht werden, wäre es sehr sinnvoll, wenn die ermittelnden Beamten sich mit den entsprechenden Experten beraten, wie im jeweiligen Fall mit den Wahrscheinlichkeiten umzugehen ist. Ich widerspreche dem Klischee, dass alle Polizisten rassistisch seien und unfähig im Umgang mit statistischen Angaben, man müsste jedoch alle Beteiligten schulen – auf allen Ebenen, in der Polizei ebenso wie bei der Strafverteidigung und im Richteramt. Die Verfassung und die Menschenrechtskonvention beinhalten den Gleichheitsgrundsatz, der ist natürlich zu wahren, und Eingriffe in die Privatsphäre müssen immer verhältnismäßig sein. Der Zweck muss es rechtfertigen, jegliche Form einer rassistischen Stereotypisierung muss verhindert werden. Aber wenn der Verdacht, durch Zeugenaussagen gestützt, etwa auf einen Mann mit stahlblauen Augen fällt, muss ich nach so jemandem suchen.
Menschen schenken Labordaten besonderen Glauben, Soziologen sprechen von einem CSI-Effekt, der selbst Gerichte beeinflussen kann. Ist das eine weitere Gefahr?
Ob Kamera, Zeugen oder DNA-Analyse: Man darf kein Medium als eine Wahrheitsmaschine ansehen, es gibt überall Fehlerquellen, im Labor, in Ermittlungen ebenso wie in den Erinnerungen der Zeugen! DNA-Spuren oder Zeugenaussagen können in die falsche Richtung weisen, auf die falsche Person. Deshalb sollte man sich nicht nur auf ein einziges Beweismittel verlassen. Um die wahren Täter zu erwischen und zu verurteilen – und zugleich möglichst wenige Unschuldige zu verdächtigen.