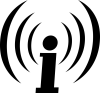Die Initiative um den Mietenvolksentscheid wird nach den Verhandlungen mit dem Senat ihr eigenes Vorhaben voraussichtlich zugunsten eines neuen „Wohnraumsversorgungsgesetzes“ aufgeben. Sowohl innerhalb der Initiative als auch außerhalb sorgt diese Entwicklung für heftige Kritik. Ein großer Teil der Gruppe dagegen sieht das Ergebnis überwiegend als Erfolg an. Abseits der fachlichen Diskussion, ob das Gesetz in seiner Form sinnvoll ist, stellt sich die Frage, wie mit dieser Entwicklung des Volksentscheids innerhalb der außerparlamentarischen stadtpolitischen Bewegung umgegangen wird.
(Dieser Artikel ist zunächst im Rahmen der Debatte um den Berliner Mietenvolksentscheid auf wirbleibenalle.org erschienen)
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
"Wir haben mit unserer Initiative innerhalb eines Jahres die Wohnungs- und Mietenpolitik in dieser Stadt so stark beeinflusst, wie keine andere Initiative, Gruppe oder Partei in den letzten Jahrzehnten. Das ist ein Grund stolz auf unsere Arbeit zu sein. Natürlich haben wir damit auf die Vorarbeit unzähliger Gruppen und Einzelpersonen aufgebaut. Wir haben aber diese Vorarbeiten zusammengefasst und mit dem Instrument des Volksbegehrens die Unterstützung der Bevölkerung organisiert. Erst diese Kombination hat die Politik zum Nachgeben gezwungen." (Ein Sprecher des Berliner Mietenvolksentscheids in einer Email an den Aktivenverteiler)
Der Funktionär spricht
Der Sprech des Sprechers ist der des Funktionärs. Wer selbst einmal Mitglied einer Partei war, erkennt die typischen Muster. Das eigene Handeln wird der Gefolgschaft verkündet, ganz nach Parteimanier wird in einem weiteren Satz eine Diskussion der Ergebnisse in Aussicht gestellt, was den Anschein basisdemokratischer Entscheidungsfindung erweckt. Dabei ist klar, dass die Ergebnisse bereits verhandelt sind. Zwischendurch klopft man sich für die historische Leistung auf die Schulter und bedankt sich bei allen fleißigen Wahlkämpfer*innen.
Da nützt es auch nichts, wenn man gnädigerweise auf die Vorarbeit anderer hinweist. Denn auch da offenbart sich ein hierarchisches Politikverständnis. Einer wie der Sprecher musste erst kommen, um das ganze Protest-Kuddelmuddel so zusammenzusetzen, dass etwas Handfestes daraus wird. Ein Volksentscheid, der von dieser Denkweise geprägt wird, konnte nie ein Volksentscheid einer Bewegung sein.
Als Bewegung kann hier eine bunte Landschaft außerparlamentarischer stadt- und sozialpolitischer Initiativen gelten, die seit Jahren viel Wind rund um die Themen Wohnen, Verdrängung und städtische Armut machen – nicht immer zusammen, auch mal im Streit, aber dennoch aus einem gemeinsamen Verständnis heraus, von unten für eine andere Stadt zu kämpfen. Ein Volksentscheid hätte durchaus ein Projekt werden können, das so einer Bewegung Kraft und Mobilisierung verleiht. Er ist es aber nicht geworden. Wie seine Zukunft aussieht, hängt auch davon ab, ob innerhalb der Initiative ein Umdenken stattfindet.
Am Anfang waren Vertrauen und Versprechen
Dem Berliner Mietenvolksentscheid wurde von Anfang an viel Vertrauen und solidarische Kritik entgegengebracht. Wohl wissend, dass so ein Projekt große Auswirkungen auf alle Gruppen und Initiativen sowie auf den umkämpften Raum der Stadt haben kann, war der Tenor: Lasst sie mal machen, die machen das schon okay. Entgegengesetzt ließen die bewegungsnahen Mitglieder der Volksentscheid-Initiative wissen: Keine Panik, das ist ein Ding der Bewegung, uns geht es hier um mehr als bloße Gesetzesänderungen.
Bunter Haufen gegen Senat
Relativ eindeutig war bereits zu Beginn, dass hier eine sehr heterogene Gruppe am Werk ist. Auf der einen Seite diejenigen, die den Entscheid als strategische Weiterentwicklung einer seit Jahren aktiven Mieter*innenbewegung gesehen haben. Als Instrument, um auf der Straße ins Gespräch zu kommen, zu mobilisieren und zu organisieren. Auf der anderen Seite die Fraktion der Expert*innen und Berater*innen, die jetzt mal richtig Politik machen anstatt dieses ewigen Protest-Kleinkleins, mit Gesetzespassagen und handfesten Ergebnissen für eine benennbare Zahl an Menschen in der Stadt, mit wichtigen Treffen mit wichtigen Menschen an wichtigen Orten.
Aufeinander trafen aber auch verschiedene Protestkulturen. Hier der Ansatz des „Everybodies Darling“ im Stile von Kotti & Co, der es erlaubt, sich mit allen an einen Tisch zu setzen. Dort das rotzig Altautonome der Kreuzberger Stadtteilini, die eigentlich mit jedem „Runden Tisch“ Probleme hat. Dazwischen dann die neue Interventionistische Linke, die ihre Identität zwischen linksradikaler Gruppe und Übergang zur sozialdemokratischen Parteiorganisation noch zu suchen scheint. Die ein Teil der Verhandlungsgruppe war, dazu dann aber wieder ein kritisches Papier veröffentlicht hat. Dann noch ein grüner Unternehmensberater, Mitglieder der Linkspartei und einige Veteran*innen vergangener Volksentscheide.
Wer sich aus so einer Ausgangslage heraus mit einem hochprofessionell ausgestatteten und nach Tempelhof taktisch top aufgestellten Senat anlegt, ohne erwartbare Szenarien rechtzeitig durchzuspielen und ein gemeinsames Vorgehen vorzubereiten, fährt eine Gruppe in den Konflikt. Dies war abzusehen. Inwiefern der Konflikt nun als problematisch gesehen wird oder lediglich als lästige Begleiterscheinung, hängt wieder von den wohl ganz unterschiedlichen Perspektiven und Erwartungen ab.
Keine historische Leistung
Neben dem Konflikt steht das Verhandlungsergebnis. Ein Gesetz, das so zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit niemals vom Senat vorgelegt worden wäre. Die fachliche Diskussion darüber kommt gerade in die Gänge, einzelne Bewertungen zeichnen sich aber schon jetzt ab: Umdenken der Berliner Wohnungspolitik / Sinnvolle Verbesserungen für eine große Zahl von Mieter*innen / Eine Schwächung der bereits erkämpften Position gegenüber den städtische Wohnungsbaugesellschaften / Schlechter Gesetzestext mit eingebauten Nachteilen für Mieter*innen / Alles nur neu aufgewärmte und gebündelte Maßnahmen, die die SPD schon seit einiger Zeit bespricht / Baut auf dem Berliner Mietenbündnis des Senats auf, das eh schon versagt hat / Bleibt insgesamt zu vage.
Auch ohne sich hier festlegen zu müssen steht fest, dass das vorliegende „Wohnraumversorgungsgesetz“ nicht den von der Volksentscheid-Initiative angestrebten Paradigmenwechsel bedeutet, bei dem die kommunale Wohnungsversorgung auf Dauer entprivatisiert und demokratisiert wird, der soziale Wohnungsbau entfristet und vom Prinzip der Eigentümersubventionierung gelöst wird, der den Bewohner*innen der Stadt Möglichkeiten gibt, sich die Stadt von unten wieder anzueignen, und der mit der Logik von Profit und Markt bricht. Inwiefern es für das jetzt vorliegende Ergebnis nun zwingend einen angedrohten Volksentscheid gebraucht hätte, ist also mehr als fragwürdig. Zu behaupten, dass hier auf einen Schlag mehr erreicht wurde als in den besagten letzten Jahrzehnten zusammengenommen, ist offensichtlich völlig vermessen.
Kein Entscheid ohne Bewegung
Viel entlarvender ist jedoch die Äußerung, nur durch die ordnende Hand des Volksentscheids hätte sich der jahrelange Protest nun das erste Mal politisch ausgewirkt. Hier liegt ein Irrtum vor - wenn man sich als Teil einer außerparlamentarischen Bewegungslandschaft versteht. Und das hat der Volksentscheid zumindest nach außen getan. Denn dass dieser Volksentscheid überhaupt so bedrohlich werden konnte, dass die erste Hürde der Unterschriften mit so einer Wucht genommen wurde, liegt daran, dass seit Jahren (und Jahrzehnten!) verschiedenste Gruppen und Initiativen – die Bewegung eben – zu diesen Themen arbeiten und mobilisieren. Und selbst die nächtlich brennenden Autos und sommerlichen Action Days vor einigen Jahren haben den Weg bereitet, der heute so einen Entscheid möglich macht. Und dass für das Sammeln der Unterschriften natürlich viele Einzelpersonen aus genau dieser Bewegung Stunden an Infotischen verbracht haben, sollte wohl klar sein.
Ein Projekt wie der Volksentscheid und eine aktive Bewegung können sich gleichberechtigt zu einem Erfolg fügen. So ist es beim Tempelhofer Feld geschehen. Ohne etwa die Aktion Squat Tempelhof und die Nachbarschaftsarbeit von Tempelhof für Alle! wäre der Volksentscheid zum Tempelhofer Feld niemals erfolgreich gewesen. Ohne diesen Volksentscheid würden wir heute aber die Bebauung des Feldes erleben. Politisch wurde ein Erfolg gefeiert, von Initiative und Bewegung zusammen, ohne dass anschließend eine Hierarchisierung von Verdiensten nötig war.
Von Anfang an zu wenig Zeit und Informationen
Wer einen Volksentscheid der Bewegung gewollt hätte, hätte von Beginn an mit mehr Zeit und mehr Transparenz vorgehen sollen. Hieran hat es der Initiative stets gefehlt.
Jetzt nur zu meckern, ist sicher einfach. Allerdings wurde von Anfang an gefordert, die Strategie und inhaltliche Ausrichtung des Entscheids mit der Bewegung zu diskutieren und zu verankern. Wie das gelingt? Mit mehr Zeit und Geduld und einem von Beginn an transparenten, offenen und radikaldemokratischen Konzept, wie der Entscheid entstehen und geführt werden soll.
Stattdessen fuhr die Volksentscheid-Initiative einen Geheimhaltungskurs sondergleichen, kombiniert mit stetigen Hinweisen auf den extremen Zeitdruck. Vereinzelte Bestrebungen, sich mit anderen Gruppen und Initiativen über den Entscheid auszutauschen, blieben lediglich einzelne Versuche. Dass die Geheimhaltung oftmals damit begründet wurde, dass man ja dem Senat gegenüber keine Möglichkeit zur taktischen Vorbereitung geben möge, wirkt angesichts der aktuellen Entwicklung besonders albern. So blieb der stete Eindruck, zumindest Teile der Initiative stünden Oppositionsparteien und Senatsrunden näher als der eigenen Bewegung.
Die Kritik ist richtig
Wenn man einen Entscheid der Bewegung gewollt hätte, hätte man schnell erkennen können, dass die Festlegung auf den Termin der Abgeordnetenhauswahl sowohl für die Verankerung in der Bewegung als auch für die eigene Stärke gegenüber den politischen Gegenspieler*innen nur zum Nachteil ist. Im Übrigen war abzusehen, dass der Senat nach dem Tempelhofdesaster mit einer echten Befriedungs- und Vereinnahmungsstrategie um die Ecke kommen würde. Auch hier hätte man sich zusammen mit Gruppen und Initiativen vorbereiten können oder zumindest sagen können, was man denn vorhat. Die Kritik an den stattgefunden Verhandlungen ergibt sich ja auch daraus, dass eine kleine Gruppe innerhalb der Initiative sich gegenüber dem Rest der Initiative, den 50.000 Unterschreibenden und den unterstützenden Gruppen verselbstständigt und sich ein Mandat für Verhandlungen gegeben hat. Dazu wurden die Verhandlungen den Kritiker*innen und Zweifler*innen lediglich als „Gespräche“ verkauft. Sowas ist vermeidbar, sowas ist mit vollem Recht zu kritisieren. Und sowas offenbart einen fehlenden Sinn für Bewegung. Hier dreht sich die Politik von unten zur Politik von oben.
Sich nicht dem Senat bei erster Gelegenheit hingeben, Geschlossenheit zeigen, sich Zeit nehmen, das alles kann auch eine Form von Verhandlungsführung sein, die die Stärke einer Bewegung nicht untergräbt. Wer hätte die Initiative daran gehindert, rechtzeitig und offen zu diskutieren, wie man sich angesichts des im Mai diesen Jahrens angekündigten Gesetzentwurfes des Senats verhält? Wer hätte die Verhandlungsgruppe daran gehindert am Ende der „Gespräche“ zu sagen, man müsse den Vorschlag des Senats zunächst in der Initiative und dann auch bei einer großen Vollversammlung der stadtpolitischen Gruppen in Ruhe diskutieren? Es liegt wohl daran, dass ein solcher Schritt den am Verhandlungstisch Sitzenden gar nicht mehr in den Sinn gekommen ist, und stattdessen in Funktionärsmanier zuerst der Presse der „Erfolg“, und anschließend der eigenen Initiative das Ergebnis präsentiert wurde.
Die Aussicht bleibt
Mit der Einladung zu einem ersten Auswertungstreffen Anfang Oktober zeigt die Volksentscheid-Initiative Bereitschaft zur Selbstkritik und Auseinandersetzung. Neben der breit angelegten fachlichen Diskussion des Gesetzestextes hat sich immerhin eine Arbeitsgruppe mit dem politischen Prozess des Entscheids beschäftigt. Nun wird sich zeigen, ob noch einmal ein Bewusstsein für eine gemeinsame Bewegung aufkommen kann. Letztendlich ist dies aber eine Angelegenheit, die alle innerhalb und außerhalb der Initiative betrifft und nicht nur eine Arbeitsgruppe.
Klar ist, dass sowohl das Gesetz als auch die öffentliche Darstellung des „Kompromisses“ die zukünftige Arbeit der stadtpolitischen Gruppen und Initiativen maßgeblich beeinflussen wird. Der Senat wird mit dem Gesetz eine Trennungslinie ziehen wollen zwischen gerechtfertigtem und überzogenem Protest. Dafür wird er die Volksentscheid-Initiative als Argumentationshilfe heranziehen. Wer in Zukunft über den Gesetzesinhalt hinausgehen will – und das ist ja nicht wirklich schwierig – wird sich damit auseinandersetzen müssen, dass eine Gruppe im Namen einer Bewegung sich von weitergehenden radikaleren Forderungen losgesagt hat. Stadtentwicklungssenator Geisel macht im neuen MieterMagazin bereits vor, wie sich der Senat das vorstellt. Man hätte zunächst gedacht, die Leute von der Initiative seien „Wirrköpfe“, also vom Schlage dieser nervigen Dauerprotestler*innen. Dann hätte man gelernt, dass es „Experten“ seien. Da liegt also die Unterscheidung zwischen richtigem und falschem Protest. Leider liegt die Vermutung nahe, dass einige Mitglieder der Initiative eine ähnliche Auffassung haben wie der Senator.
Entscheiden, auf welcher Seite man steht
Ob mit oder ohne Volksentscheid, ob mit oder ohne neuem Gesetz, die Situation hunderttausender Menschen in der Stadt bleibt schlecht. Staatliche Wohnungspolitik ist hier ein wichtiges Feld, aber mit Sicherheit nicht das einzige. Das Vorgehen der privaten Eigentümer*innen, städtische Armut, Gängelung durch die Behörden, rassistische Diskriminierung und Ausgrenzung oder auch die Situation der Geflüchteten sind Themen, die Protest und Organisierung dringend nötig machen. Von der Volksentscheid-Initiative darf erwartet werden, dass sie sich zu weitergehenden Kämpfen in der Stadt solidarisch verhält, und zwar nicht nur als leeres Versprechen, sondern als politische Priorität und Zeichen, verlorenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Es darf sogar eingefordert werden, dass die entstandene Machtposition der Verhandler*innen inklusive der sicherlich vorhandenen direkten Kontakte in die Senatsebene genutzt werden um auch andere Forderungen zu artikulieren. Sollte die Volksentscheid-Inititative sich einer solchen Entwicklung versperren, dürfte sie aus der Bewegung kein Vertrauen und keine Unterstützung mehr erhalten. Sie hätte dann die Seite gewechselt.
Mapu