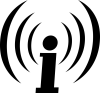Kritische Theorie zwischen Akademisierung und Epigonentum. von Robert Zwarg.
Rüdiger Stolzenburg ist ein armes Würstchen. Seit Jahren fristet er sein Dasein an einem chronisch unterfinanzierten, kulturwissenschaftlichen Institut vom Lohn einer halben Stelle. Seine Aufstiegschancen sind gleich null, er verachtet seine Studenten, verabscheut den akademischen Alltagsbetrieb, in dem er zu Freundschaftsdiensten und Klüngelei gezwungen wird, und für seine einzige Leidenschaft – die Edition des Nachlasses eines obskuren Mozart-Zeitgenossen – will sich einfach kein Geld auftreiben lassen. Während das Elend seines Arbeitslebens zunehmend Wut, Zynismus und gelegentlich sogar Widerstand erzeugt, ist er im Sozialen rückgratlos und passiv. Seine Selbsteinschätzung als »bindungsunfähig« vertreibt eine Frau nach der anderen, seine Tochter ist ihm fremd – die »Zeit läuft ab, seine Zeit«. Rüdiger Stolzenburg, der tragisch-blasse Protagonist aus Christoph Heins Roman »Weißkerns Nachlass«, hätte Peter Gutman wahrscheinlich gehasst. Gut situiert, verbringt der Professor einen Aufenthalt als Gastwissenschaftler an einem prestigeträchtigen Forschungsinstitut in Los Angeles und denkt einzig und allein über »seinen Philosophen« nach. Wie dieser steht Gutman quer zu den akademischen Disziplinen, auf der Grenze zwischen Philosophie, Literatur- und Kulturwissenschaft. Anders als Stolzenburg hat er die Möglichkeit, sich ganz in seinen Gegenstand zu vertiefen. Er denkt und spricht durch »seinen Philosophen« hindurch, verweist auf ihn in noch der banalsten Alltagssituation. Gutmans asketische Lebeweise ist selbstgewählt, sein anachronistisches Einzelgängertum souverän. Wer »sein Philosoph« ist, lässt Christa Wolfs Roman »Stadt der Engel« offen. Doch es gehörte im Jahr 2010, als der Roman erschien, nicht viel dazu, hinter den Anspielungen und indirekten Zitaten »des Philosophen« Walter Benjamin zu erkennen; spätestens als Gutman beim abendlichen Gespräch vom Engel der Geschichte, von Fortschritt und Utopie spricht.
Sowohl der Roman als solcher wie auch die Figur Peter Gutmans – hinter der sich, charakteristisch für die Romane Christa Wolfs, ein echter Benjamin-Forscher verbirgt – sind Hinweise darauf, dass die Kritische Theorie in Kultur und Wissenschaft hierzulande einen festen Platz einnimmt. Vielfach übersetzt und in zahllosen Varianten wiederveröffentlicht, finanzieren die Schriften Theodor W. Adornos und Walter Benjamins aus der Backlist des Suhrkamp-Verlags eine Giorgio-Agamben-Ausgabe nach der anderen. Ganze Bibliotheken ließen sich mit der Sekundärliteratur zur Kritischen Theorie füllen: Einführungen, Exegesen, Kritiken, Vergleiche und Handbücher. Noch im letzten Vorlesungsverzeichnis wird sich ein Seminar zu Adorno finden lassen, und wo es fehlt, übernehmen Lesekreise das Angebot. Wer im Titel an Erich von Däniken orientierte Konferenzen über Erinnerung und Zukunft verpasst, findet ohne Zweifel ein entsprechendes Panel bei einer der Zusammenkünfte linker Geisteswissenschaftler. In Amerika, wo »Critical Theory« zur Chiffre für kontinentale Philosophie von Kant über Adorno bis hin zu Gilles Deleuze und Slavoj Žižek geworden ist, können die Engagiertesten und Belesensten gar einen Abschluss unter selbigem Titel erwerben. Anders gesagt, für die antispezialistische Denktradition par excellence gibt es heute zahlreiche Spezialisten, die sich den Markt der Nachlassverwaltung sorgsam aufteilen. Falsch ist es deswegen, mit existentialistischem Raunen von vermeintlich nur noch vorhandenen »Fetzen Kritischer Theorie« zu sprechen (1); richtiger wäre es, die Kritische Theorie als integrierten Bestandteil eines bei aller Vielfalt monolithischen Betriebs zu betrachten.
Die Kritische Theorie hat ihre eigene Akademisierung durchaus antizipiert, wie sie überhaupt einen wachsamen Blick für die Universität hatte, die sie nicht zufällig einen »Betrieb« nannte. Vor allem an Adorno lässt sich jedoch ablesen, dass hinter jener Wissenschaftskritik auch die Hoffnung stand, in der Hochschule ein Refugium für die freie Entfaltung des Geistes und des kritischen Denkens zu finden. Von dem historisch einmaligen Ineinander von radikaler Gesellschaftskritik und wissenschaftlicher Institutionalisierung lebt die Faszination an der Kritischen Theorie auch heute noch. Tatsächlich aber verbirgt sich hinter dieser Konstellation ein Widerspruch, der bereits für die Vertreter der ersten Generation spürbar war und sich heute noch verschärft hat. Peter Gutman und Rüdiger Stolzenburg verkörpern die zwei Seiten dieses Widerspruchs: Sie verhalten sich zueinander wie der Wunsch zur Realität. Hier der finanziell abgesicherte Professor Gutman, nicht gebunden an Disziplinen, der kritische Denker und leidenschaftliche Spezialist für diesen einen Philosophen; dort der zynische, frustrierte und intellektuell verarmte Einzelwissenschaftler Stolzenburg als Vertreter einer tendenziell überflüssigen akademischen Angestelltenklasse. Dass die universitäre Wirklichkeit eher auf das Modell Stolzenburg hinzutreiben scheint, belegt nicht zuletzt die Umstrukturierung der Hochschulen zu Massenuniversitäten. Aber auch das, was Peter Gutman verkörpert, ist allenfalls noch als Simulation möglich.
Gebrochenes Wissenschaftsethos
Von der Verbreitung der Kritischen Theorie zu sprechen, als wäre bereits die bloße Zirkulation ein Erfolg, unterschlägt die Veränderungen, die diese über die Jahre durchgemacht hat. Je höher man die akademische Stufenleiter hinaufklettert, je weiter man sich ins Zentrum des Kultur- und Universitätsbetriebs begibt, umso stärker wird der Widerwille gegen den Jazz verachtenden Pessimisten Adorno und die von ihm mitbegründete Kritische Theorie der Gesellschaft, umso mehr dominiert Exegese statt Aktualisierung, umso mächtiger wird das Deutungsmonopol der zweiten und dritten Generation, verbunden mit den Namen Jürgen Habermas und Axel Honneth. Schon die Rede von der »Frankfurter Schule«, die ihre Protagonisten meistens vermieden und, wenn überhaupt, nur indirekt aufnahmen, entsprach vor allem dem Bedürfnis, ein liberales Aushängeschild für die vermeintlich geläuterte postnazistische Bundesrepublik zu finden. Ihre Wahrheit hat die Bezeichnung darin, dass vor allem Max Horkheimer, als er 1931 das Institut für Sozialforschung von Carl Grünberg übernahm, seine Aufgabe durchaus programmatisch verstand. Die Institutionalisierung eines nicht dogmatischen Verständnisses von Marx und einer über die Einzelwissenschaften hinausgehenden Sozialphilosophie war verbunden mit der Hoffnung auf eine Wirkung der Kritischen Theorie über ihre unmittelbaren Protagonisten hinaus; mit anderen Worten, auf Konstitution einer Schule. Horkheimer wusste um die Grenzen eines solchen Projekts. Schon damals ermangelte es der »Konstruktion der Gesellschaft unter dem Bilde einer radikalen Umwandlung, das die Probe seiner realen Möglichkeit noch gar nicht bestanden hat«, (2) einer historischen Kraft. Und selbst wenn es wenigstens zu einer »einheitlichen Theoriebildung« käme, so Horkheimer, wäre auch diese noch kein Garant für ihre Verwirklichung, ihr Praktischwerden. Bedingung des »geschichtlichen Erfolgs« war für Horkheimer somit etwas entschieden anderes als die Inflationierung akademischer Diskurse heute, nämlich die »möglichst strenge Weitergabe der kritischen Theorie«. (3) Dies schloss historische Veränderungen mit ein, befindet die Kritische Theorie sich doch bis zu ihrer Verwirklichung in einem ewigen Zustand der Falsifikation. Bis zu ihrem Sieg, so Horkheimer enthusiastisch, »währt auch der Kampf um ihre richtige Fassung und Anwendung«. (4)
In das Institut für Sozialforschung als institutionellem Rahmen dieses Kampfes setzten Horkheimer und sein Umfeld einige Hoffnung. Aus der Marginalität der Selbstkritik des Marxismus und nur mit Hilfe eines sozialistischen Millionärs geboren, schien das Institut einige Jahre lang tatsächlich nicht nur ein politisches, sondern auch ein wissenschaftsorganisatorisches Vakuum zu füllen. Noch bevor »Interdisziplinarität« zum Schlagwort eines in unzählige Unterdisziplinen zerfallenden Universitätsbetriebs wurde, kritisierte Horkheimer das »Chaos des Spezialistentums«, (5) das Nebeneinander von einzelwissenschaftlicher, empirischer Forschung und synthetisierender Philosophie. Zwischen der bereits allgegenwärtigen Fundamentalontologie Martin Heideggers, der Lebensphilosophie und dem romantischen Spiritualismus einerseits und dem Neopositivismus und Empirismus anderseits vertraute der Frankfurter Kreis darauf, dass die Philosophie als »aufs Allgemeine, ›Wesentliche‹ gerichtete theoretische Intention den besonderen Forschungen beseelende Impulse zu geben vermag und zugleich weltoffen genug ist, um sich selbst von dem Fortgang der konkreten Studien beeindrucken und verändern zu lassen«. (6) Die erste Ausgabe der Zeitschrift für Sozialforschung führte dementsprechend Aufsätze zur Sozialpsychologie, zu Karl Marx, zur zeitgenössischen Literatur, zur Freizeitgestaltung und zur Musik in ihrem Register, außerdem einen sehr umfangreichen Besprechungsteil.
Das Programm des Instituts für Sozialforschung war geboren worden aus dem Geiste einer konkreten Kritik des damaligen Wissenschaftsbetriebs, beruhte jedoch auf einem tiefen Vertrauen in Geist und akademische Bildung, das auf das 18. und 19. Jahrhundert, auf den deutschen Idealismus und Wilhelm von Humboldt, zurückging. Schon Immanuel Kant, auf den sich Horkheimer zeit seines Lebens berief, hatte in der »Kritik der reinen Vernunft« dem Schulbegriff der Philosophie – »ein System der Erkenntnis, die nur als Wissenschaft gesucht wird« (7) – ihren Weltbegriff nicht nur gegenübergestellt, sondern zugrunde gelegt. Der Weltbegriff der Philosophie zielt nicht auf bloße logische Stringenz, sondern er betrifft, »was jedermann notwendig interessiert«. (8) Gebrochen war der Forschungsoptimismus der Kritischen Theorie allerdings von Anfang an durch die hellsichtige Beobachtung der Binnenlogik des akademischen Betriebs als einem – wie Horkheimer später schreiben sollte – »Racket«, eine Einsicht in die Wissenschaft als Produktivkraft und Produktionsverhältnis gleichermaßen und die geschichtsphilosophische Überzeugung, dass die fast zur gleichen Zeit stattfindende Akademisierung des Marxismus eher ein Symptom der Niederlage als des wissenschaftlichen oder politischen Triumphes des historischen Materialismus war. Obgleich Horkheimer sich positiv auf die »Diktatur des Direktors« berief und dieser Funktion – wie vielfach belegt – vollständig nachkam, nahm er sehr wohl die »persönliche Konkurrenz und Reklamesucht der akademischen Teilnehmer« (9) wahr. Die vielleicht von der Kritischen Theorie erstmals verwendete Rede von Wissenschaft als »Betrieb« war Ausdruck einer Reflexion auf die Lüge der Autonomie der Universität: »Der Gelehrte und seine Wissenschaft sind in den gesellschaftlichen Apparat eingespannt, ihre Leistung ist ein Moment der Selbsterhaltung, der fortwährenden Reproduktion des Bestehenden, gleichviel, was sie sich selbst für einen Reim darauf machen.« (10)
Das zielte nicht nur auf die bürgerlichen, sondern auch auf die sowjetmarxistischen Vertreter der Wissenschaft, die sich emsig bemühten, ihre Gegner an logisch-positivistischer Strenge und naturwissenschaftlicher Evidenz zu übertrumpfen. Horkheimer wusste sehr genau, dass die einstige Hoffnung auf das Proletariat – bei ihm selbst in den frühen Schriften noch deutlich spürbar – obsolet geworden war; nicht nur, weil die Revolution in der Sowjetunion die Strahlkraft ihrer Anfangszeit längst verloren hatte und sich die Arbeiterklasse wenig fortschrittlich zeigte, sondern weil sich in den zwanziger Jahren schon andeutete, was später kaum mehr zu verbergen war: der Weg des Marxismus »von den Fabriken in die Akademien« (Murray Bookchin).
Karl Korsch und Georg Lukács waren die ersten, denen aufgrund ihrer dezidiert philosophischen Auseinandersetzung mit Karl Marx der Vorwurf eines professoralen Kommunismus gemacht wurde. Und das Institut für Sozialforschung war, ob beabsichtigt oder nicht, selbst ein Teil dieser Akademisierung des Marxismus. Die »Übersetzung des Marxismus in den akademischen Stil« deutete Horkheimer in der Nachkriegszeit als weiteres Zeichen dafür, dass das Band zwischen Theorie und ihrer praktischen Verwirklichung gerissen sei, als ein Indiz für die Überflüssigkeit der »Professoren als berufenen intellektuellen Vertreter der Menschheit«. (11) Obgleich Horkheimer und Adorno Marx weiter lehrten und von einer Abkehr vom Marxismus bei ihnen keine Rede sein kann, (12) hatte dieser für Horkheimer seine Gefährlichkeit fast vollständig eingebüßt. An die Adresse der Wissenssoziologie Karl Mannheims schrieb er in »Dämmerung«: »Jetzt haben sie ihn (Marx) sauber formuliert als Relativität der Erkenntnis, als Historizität geisteswissenschaftlicher Theorie und anderes mehr.« (13)
Dem Markt entgeht keine Theorie
Was in der frühen Kritischen Theorie noch nebeneinander existierte – Wissenschaftskritik und Wissenschaftsenthusiasmus, zusammengehalten durch einen institutionellen Rahmen –, sollte sich mit der Emigration zum Widerspruch zuspitzen. Das bürgerliche Erbe, von dem die Hoffnung auf wissenschaftlich zu erlangende Wahrheit lebte, war durch den Nationalsozialismus und die Vernichtung, für die der Name Auschwitz steht, unwiederbringlich zerstört worden. Gleichzeitig schienen das Exil in Amerika und der Kontakt mit dem dortigen, stärker professionalisierten, ökonomisch durchdrungenen und empirisch ausgerichteten Universitätsbetrieb die Hoffnungen in die Akademie nachhaltig angegriffen zu haben. Bereits in der »Dialektik der Aufklärung«, jenem Buch, das die nachfolgende Generation von Denkern im Anschluss an Jürgen Habermas fast einstimmig als Apostasie der Kritischen Theorie von ihrem frühen Programm einschätzt, nehmen Adorno und Horkheimer auf ihr verändertes Verhältnis zur Universität Bezug. Demzufolge sind die philosophischen Fragmente auch eine Reaktion auf den Verfall der wissenschaftlichen Vernunft, der die beiden Autoren vor dem Nationalsozialismus, wie auch immer gebrochen, vertraut hatten. Fragmentarisch ist das Buch nicht nur, weil sich die Wirklichkeit einer systematischen Darstellung sperrt, sondern auch, so die Vorrede, weil die »Kritik und Fortführung fachlicher Lehren« nicht länger ausreichte. »Bildet die aufmerksame Pflege und Prüfung der wissenschaftlichen Überlieferung, besonders dort, wo sie von positivistischen Reinigern als nutzloser Ballast dem Vergessen überantwortet wird, ein Moment der Erkenntnis, so ist dafür im gegenwärtigen Zusammenbruch der bürgerlichen Zivilisation nicht bloß der Betrieb, sondern der Sinn von Wissenschaft fraglich geworden.« (14)
Nicht nur die philosophische Erkenntnis, dass weder wissenschaftliche noch historische Vernunft den Nationalsozialismus verhindert hatten, mag für diese Zweifel verantwortlich gewesen sein, sondern auch die Ambivalenz der »amerikanischen Erfahrung« (Adorno) selbst. Was Adorno an Amerika positiv hervorhob – das »Prinzip der Humanität«, eine im Alltag sedimentierte Demokratie und prinzipielle Offenheit –, zeigte sich ihm erst post festum und es ist sehr wahrscheinlich, dass die lobenden Worte, die Adorno in den sechziger Jahren für Amerika fand, auch eine Reaktion auf den weit verbreitenden Antiamerikanismus unter den linken Studierenden war. Vor der Rückkehr nach Deutschland war Adorno allerdings zum ersten Mal mit einem Leben konfrontiert, das dem Rüdiger Stolzenburgs keineswegs so unähnlich war. Vollständig auf das Institut für Sozialforschung konzentriert und angewiesen, war Adorno abhängig von den finanziellen Erwägungen Horkheimers und Friedrich Pollocks. (15) Auch nach der Anbindung an die Columbia University blieb die Situation des Instituts prekär, die Versuche der Integration in den amerikanischen Wissenschaftsbetrieb erforderten Anpassung und Rechtfertigung gegenüber den politischen und ökonomischen Sachzwängen empirischer Forschung. Horkheimers »Eclipse of Reason« (»Kritik der instrumentellen Vernunft«) – dessen Konzeption und Verschriftlichung parallel zur »Dialektik der Aufklärung« verlief – war nicht nur der Versuch, möglicherweise doch dauerhaft in Amerika Fuß zu fassen, sondern vielleicht auch das letzte Projekt, das auf die Möglichkeit der Selbstkritik wissenschaftlicher Vernunft vertraute. Das Buch war für den amerikanischen Markt geschrieben und widmete sich in weiten Teilen den damals avanciertesten philosophischen Strömungen, wie dem Pragmatismus und der neothomistischen Naturphilosophie. Horkheimers Hoffnungen auf den Erfolg von »Eclipse of Reason« wurden jedoch enttäuscht, und es ist zu vermuten, dass sein verstärktes Engagement für eine Rückkehr in die Bundesrepublik seine Energie auch aus diesem Scheitern bezog.
Ließ sich das frühe Institut für Sozialforschung noch als Bündelung derjenigen Kräfte verstehen, die der offiziellen Wissenschaft oppositionell gegenüberstanden, galten Adorno und Horkheimer eben diese Kräfte nach dem Zweiten Weltkrieg ebenfalls als korrumpiert und ihre Begriffssprache als obsolet: »Kein Ausdruck bietet sich mehr an, der nicht zum Einverständnis mit herrschenden Denkrichtungen hinstrebte, und was die abgegriffene Sprache nicht selbsttätig leistet, wird von den gesellschaftlichen Maschinerien präzis nachgeholt.« (16) Adornos Bemühen um eine nicht abgegriffene Sprache war nicht nur der Versuch, mit der These der Untrennbarkeit von Inhalt und Form Ernst zu machen, sondern auch Widerstand gegen den Formalismus des akademischen Betriebs und seinen raunenden, existentialistischen Gegenpart. Was heute wohl nur noch als Geste möglich ist, als mal bessere und mal schlechtere Imitation, hatte aber schon bei Adorno ein Moment von Vergeblichkeit. Die einst durch die Philosophie herzustellende Einheit der Wissenschaft ließ sich nicht restituieren; auch deshalb trat die »Negative Dialektik« als »letzte Philosophie« auf. Noch bevor Adorno die Denkbewegung seines letzten zu Lebzeiten veröffentlichten großen Werkes begann, räumte er bereits dessen geringe Möglichkeit ein, den integrativen Kräften der Kulturindustrie zu entkommen: »Dem Markt entgeht keine Theorie mehr: eine jede wird als mögliche unter den konkurrierenden Meinungen ausgeboten, alle zur Wahl gestellt, alle geschluckt.« (17)
Davon waren nicht nur die Universität als Institution und der alte Glauben an das in der Wissenschaft verkörperte allgemeine Interesse betroffen. Auch wer, wie Adorno und viele andere, denen der akademische Betrieb zu eng war, sich an eine breite Öffentlichkeit richtete, war mit denselben Zwängen konfrontiert. Während das staatliche Beamtensystem die Professoren wenigstens des ökonomischen Drucks enthoben hatte, muss der »Philosoph als Schriftsteller ( ...) gleichsam in jedem Augenblick etwas Piekfeines, Erlesenes bieten, durchs Monopol der Seltenheit gegen das des Amtes sich behaupten«. (18) Als hätte Adorno geahnt, dass die Öffentlichkeit einmal von den Safranskis, Prechts, Sloterdijks und Žižeks bevölkert würde, bescheinigte er dem nichtakademischen Philosophen eine »fatale Affinität zu Kunstgewerbe, Seelenkitsch und sektiererischer Halbbildung«. (19) Adornos Begriff der Halbbildung ist die Spannung zwischen Verfall von Bildung und ihrem einstigen befreienden Potential immanent. Hatte sich die Idee der Bildung im 18. Jahrhundert gleichzeitig mit ihrem historischen Träger, dem Bürgertum, emanzipiert, schlägt sie im Zeitalter der Kulturindustrie in »sozialisierte Halbbildung« um. Sie ist »Bilderersatz« für eine phantasielos gewordene Vernunft zwischen Faktengläubigkeit und hypostasierter Meinung, der vom »Fetischcharakter der Ware ergriffene Geist«. (20) Als Ausweg konnte Adorno allerdings lediglich den »Anachronismus« anführen, »an Bildung festzuhalten, nachdem die Gesellschaft ihr die Basis entzog«. (21)
Es wäre verfehlt, von einer Resignation der Kritischen Theorie gegenüber dem akademischen Betrieb zu sprechen. Doch die Funktion eines institutionalisierten schlechten Gewissens, die das wiedereröffnete Institut für Sozialforschung nolens volens innehatte, sowie die stärkere bildungspolitische Integration führten zu persönlichen und philosophischen Spannungen. Wie das Betriebliche an der Universität im Alltag ausschlägt, ist den unzähligen Briefen zwischen Adorno und Horkheimer zu entnehmen, die zwischen der Abscheu gegenüber Klüngeleien und Ränkespielen auf der einen Seite und dem notwendigen und zuweilen in aller Schärfe und Häme vollzogenen Taktieren und Paktieren anderseits schwanken. Die philosophische Herausforderung, die aus den Zweifeln an der Akademie erwachsen war, lässt sich wohl nirgends deutlicher wahrnehmen als im sogenannten Positivismusstreit Anfang der sechziger Jahre. Was als eine der wichtigsten Wissenschaftskontroversen zumindest in die Geschichtsbücher der Soziologie einging, war für Adorno ein Ereignis, dessen Charakter als »Kontroverse« im Rahmen der Universität gerade in Frage gestellt wurde. Im Hinblick auf die Inhalte der hier vermeintlich über Kreuz liegenden Denkschulen war Adorno geradezu diplomatisch: »Wie eine dialektische Theorie der Gesellschaft nicht einfach das Desiderat von Wertfreiheit wegwischt, sondern es samt dem entgegengesetzten in sich aufzuheben trachtet, so sollte sie zum Positivismus insgesamt sich verhalten.« (22) Viel entscheidender war – und deshalb mag Adornos »Einleitung zum ›Positivismusstreit in der deutschen Soziologie‹« so ausführlich geraten sein –, dass die Debatte die Möglichkeit eines fruchtbaren Streits selbst fraglich erscheinen ließ. Über den Sinn zentraler Kategorien wie »Totalität«, »Wesen« und »Erscheinung« ließ sich auf dem Terrain des Positivismus, auf das zu begeben das Prinzip der immanenten Kritik doch fordert, schlicht nicht diskutieren. Wo »logische Immanenz selber, unter Absehung von jeglichem besonderen Inhalt, zum alleinigen Maß erhoben wird«, (23) dort muss Kritik transzendent verfahren, wenn sie von der Logik des Zwangs nichts erfasst werden möchte; und damit recht eigentlich unwissenschaftlich. Dass Adorno in diesem Zusammenhang von dem Adjektiv »positivistisch« abrückte und stattdessen das Wort »szientistisch« verwendete, war Einsicht und Notlösung zugleich. Vor allem in seiner später von Habermas popularisierten Substantivierung als »Szientismus« war damit die Vorstellung einer sich lediglich überhebenden, sich selbst übersteigenden Wissenschaft verbunden, die die Möglichkeit einer Selbstkritik der Wissenschaft bot, ohne an den Grundfesten zu rütteln.
Viel tiefer reichte jedoch Adornos Ahnung, dass, was er als Positivismus kritisierte, vielleicht Bestandteil jeder Wissenschaft unter den gegebenen Verhältnissen sein könnte. Daher rührten seine Zweifel, im akademischen Rahmen übberhaupt zum Kern des Streits vorzudringen. Den »geistige(n) Ort, an dem solches möglich wäre«, konnte Adorno tatsächlich nur utopisch benennen, als »Niemandsland des Gedankens«. (24) Die Universität seiner Zeit war von diesem Bild weit entfernt. Als Adorno im Rahmen einer Vorlesung aus derselben Zeit sich dem Vorwurf ausgesetzt sah, gegenüber Heidegger »nicht akademisch argumentiert« zu haben, rechtfertigte er sich gegenüber den Studierenden damit, dass »Philosophie heute, wenn sie überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat und wenn sie sich nicht wirklich in einen platten Betrieb verwandeln soll, der nur deshalb weitergeht, weil es ihn einmalig gibt, ihre Berechtigung allein und ausschließlich an der Stelle hat, an der sie die Vorstellung des Akademischen sprengt«. (25)
Akademisierung und Epigonentum
In einer späten Notiz, die für eine Fortsetzung der »Minima Moralia« gedacht war, äußert sich Adorno zutiefst misstrauisch gegenüber dem Beruf des Universitätsprofessors, den er jahrelang ausübte. Umsonst seien letztlich die für den Traum von geistiger Unabhängigkeit zu erbringenden Opfer, wie die »Elends- und Wartejahre der Assistenten- und Privatdozentenzeit«, und zwar nicht nur aufgrund des Zwangs, »in der Hierarchie sich zu ducken«, sondern durch den »Charakter der Wissenschaft selbst, die im Namen von Wissenschaft den Geist verneint, den sie verheißt«. (26) Für diese Spannung zwischen Wunsch und zu erwartender Realität stehen die eingangs erwähnten Figuren von Peter Gutman und Rüdiger Stolzenburg. Das Glück, für die Leidenschaft am Denken auch noch bezahlt zu werden, womöglich ins Denken selber aufzunehmen, was in der Praxis bisher misslang, macht bis heute die Anziehungskraft einer Figur wie Peter Gutman und den intellektuellen Vorbildern, von denen sie lebt, aus. Schon 1984 hatte Wolfgang Pohrt Vertretern der zweiten, sich ausdrücklich von Habermas distanzierenden Generation empfohlen, sich nicht der Illusion hinzugeben, den historischen Zufall eines »Staatsfeindes auf dem Lehrstuhl« wiederholen zu können. (27) Aber bereits damals wartete auf die Adressaten keineswegs die große akademische Karriere; wer es in den siebziger und achtziger Jahre mit dem, was er gerne tat, auf eine Universitätsstelle schaffte, profitierte hauptsächlich vom kurzen Revival marxistischer Theorie und den Bildungsreformen nach 1968. Doch die prestigeträchtigen Posten wurden schon damals an andere vergeben; an die größeren Opportunisten und an jene, die dem wissenschaftlichen Zeitgeist besser entsprachen.
In der heutigen akademischen Wirklichkeit ist ein Rüdiger Stolzenburg wahrscheinlicher als das vermeintliche Glück des Peter Gutman. Es ist eine Wirklichkeit, in der sich die Herausgeber eines »Klassiker Auslegen« betitelten Bandes zur »Negativen Dialektik« förmlich durch die Sprache winden, um ihren »ausdrücklichen Abstand zu Adornos Text« (28) als Treue zu dessen Werk zu verkaufen. Die auf Adorno gemünzte, herablassende Rede von der »routiniert eingesetzte(n) Idee«, dem »erstarrte(n) Verweis« und der »Wiederholung der Formel« steht stellvertretend für die generelle Haltung der oberen akademischen Liga, die Adorno meist nur dann akzeptiert, wenn er am vermeintlichen state of the art gemessen wird. So begibt sich die akademisierte Kritische Theorie in die Situation eines eigentümlichen double bind: Während sie sich einerseits beständig auf die intellektuellen Vorbilder beruft, muss sie gleichzeitig unterstellen, die großen Meister hätten längst nicht alles zu Ende gedacht. Nur selten wird der Versuch unternommen, die Theorie tatsächlich an der Wirklichkeit zu erproben, woran sich doch ihre Aktualität gerade bemessen würde. Viel näher liegen Exegese, Rekonstruktion oder der wie auch immer geartete Bezug auf das tägliche Brot der Geisteswissenschaften: andere Theorien. Die »Sklavensprache« (Bertolt Brecht), die zu adaptieren ist, wenn man in diesen Kreisen mitspielen möchte, lehrt heutzutage jeder Leitfaden zur Bewerbung um ein Stipendium oder auch die Selbstbeschreibung des Frankfurter Exzellenzclusters »Die Herausbildung normativer Ordnungen«.
Es ist diese akademische Wirklichkeit, die auch jene ins Konkurrenzverhältnis zwingt, die sich von Wissenschaft tatsächlich mehr erwarten als den interesselosen Vergleich verschiedener »Theorieansätze« mit marginalem Wirklichkeitsbezug. Deren raison d’être – wo sie noch als engagierte, linke Geisteswissenschaftler auftreten – besteht in der falschen Prämisse, dass die Praxis misslang, sei ein Fehler der Theorie gewesen; und damit der Grund für die nächste Konferenz zum Marxismus oder zur Kritischen Theorie. Wo aber die Hoffnung besteht, der Name Marx, Adorno oder Benjamin im Titel der Dissertation könne als Ticket in den akademischen Betrieb dienen, und wo unzählige andere genauso denken, müssen die Ideen zwangsläufig zum Bestandteil des eigenen Portfolios werden, mit anderen Worten: zum Eigentum. Auch das emphatische Bekenntnis zur Kritischen Theorie, das deren akademische und politische Marginalität durch Sendungsbewusstsein und adornisierende Existentialismen kompensiert, ist vom schielenden Blick auf die Türen der Universität begleitet. Weniges ist gegen diesen Wunsch einzuwenden; noch immer ist ein Universitätsjob vielen anderen vorzuziehen und der Zwang zur Vermarktung betrifft alle gleichermaßen. Aber gerade dort, wo Kritik zum Berufsprofil gehört, läuft sie Gefahr, zur »puren Schlauheit erniedrigt« zu werden, »die sich nichts vormachen lässt und den Kontrahenten drankriegt, ein Mittel des Vorwärtskommens«. (29) Das Epigonentum ist nicht das ganz Andere des Wissenschaftsbetriebs, sondern dessen Spiegelung. Insgeheim werden die Sekundärtugenden eingeübt, von denen man sich beständig distanziert: Networking, Sprachkompetenz und nicht zuletzt ein bis zur Selbstaufopferung gehendes Arbeitspensum. Es ist diese sich in Sprache und Gestus niederschlagende Überidentifikation mit dem Werk Adornos und anderer, die der Rede von »erstarrten Hinweisen« und »routinierten Formeln« gegen ihre eigene Intention ein gewisses Recht gibt.
Die anhaltende Anziehungskraft der intellektuellen Biographien der Kritischen Theoretiker, die wohl nicht wenig zum affektiven Verhältnis zu ihren Schriften beiträgt, hat ihren Grund aber darüber hinaus in einer Gesellschaft samt ihrer Wissenschaft, die beständig versagt, was die Theorie einmal wollte und was das Bild bürgerlicher Intellektualität verspricht. Hilflos und nicht selten lächerlich wirken die Bemühungen, mit dem Fleiß von Musterschülern den Bildungskanon des 19. Jahrhunderts nachzuarbeiten oder statt zum Techno- ins Beethoven-Konzert zu gehen; so angenehm diese Tätigkeiten für sich genommen sein mögen. Das Schicksal eines Rüdiger Stolzenburg wird damit nicht weniger wahrscheinlich. Peter Gutman wiederum, als Personifikation des Zwang und Not enthobenen freien Denkens, der Möglichkeit der Versenkung ins Detail, haftet nicht nur etwas Anachronistisches an, sondern im Grunde ist die Figur gebrochen, mehr als es der Projektion, die sie sich zum Wunschbild macht, bewusst sein mag. So privilegiert und komfortabel seine Stellung sein mag, eigentlich verzweifelt Gutman an »seinem Philosophen« und ist unfähig, seine Gedanken in einem Buch zusammenzufassen; vielleicht auch deshalb, weil schon zu viel geschrieben wurde.
Anmerkungen
(1) So der Titel eines in Berlin am 20. Juni 2013 gehaltenen Vortrags von Arne Kellermann: »Fetzen kritischer Theorie in Zeiten konstitutiver Überflüssigkeit. Zur Stellung der Überbleibsel des Denkens zum stacheligen Objekt«.
(2) Max Horkheimer: Traditionelle und kritische Theorie, HGS 4, S. 214
(3) Ebd.
(4) Ebd., S. 215
(5) Max Horkheimer: Die gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für Sozialforschung, HGS 3, S. 29
(6) Ebd. – Vgl. dazu ausführlich Helmut Dubiel: Wissenschaftsorganisation und politische Erfahrung. Studien zur frühen Kritischen Theorie, Frankfurt/Main 1978, S. 137 ff.
(7) Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Hamburg 1998, B 866
(8) Ebd., B 868
(9) Max Horkheimer: Dämmerung, HGS 2, S. 317
(10) Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 170
(11) Horkheimer, Dämmerung, S. 329
(12) Dirk Braunstein: Adornos Kritik der politischen Ökonomie, Bielefeld 2011
(13) Horkheimer, Dämmerung, S. 393
(14) Theodor W. Adorno/Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, HGS 5, S. 16
(15) Vgl. Detlev Claussen: Theodor W. Adorno – Ein letztes Genie, Frankfurt/Main 2006, S. 220 f.
(16) Ebd., S. 18
(17) Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, GS 6, S. 16
(18) Ders.: Minima Moralia, GS 4, S. 74
(19) Ebd., S. 75
(20) Ders., Theorie der Halbbildung, GS 8, S. 108
(21) Ebd., S. 121
(22) Theodor W. Adorno: Einleitung zum »Positivismusstreit in der deutschen Soziologie«, GS 8, S. 279 ff., hier S. 348
(23) Ebd., S. 281
(24) Ebd., S. 283
(25) Theodor W. Adorno: Philosophische Terminologie, Bd. 1., Frankfurt/Main 1973, S. 165
(26) Zit. nach Claussen, Ein letztes Genie, S. 381.
(27) Vgl. Wolfgang Pohrt: Der Staatsfeind auf dem Lehrstuhl, in: Ders.: Gewalt und Politik, Berlin 2010, S. 137 ff.
(28) Axel Honneth/Christoph Menke: Zur Einführung, in: Dies. (Hrsg.): Theodor W. Adorno. Negative Dialektik, Klassiker Auslegen, Bd. 28, Berlin 2006, S. 5
(29) Adorno: Theorie der Halbbildung, S. 115
Überarbeitete Version eines am 29. November in der »Freien Uni Bamberg« gehaltenen Vortrages. Für wertvolle Hinweise und Diskussionen danke ich Jan Gerber.