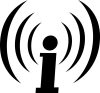Es sind zwei außergewöhnliche Jahre, die hinter Deutschland liegen, zwei Jahre der Nervosität und Verunsicherung, zwei Jahre, in denen das Politische neue Hitzegrade erreicht hat, international sowieso, aber auch in der Bundesrepublik: Russlands Annexion der Krim, der Brexit, Donald Trumps Wahlsieg. Und im Innern: Merkels Entscheidung, Flüchtlinge ins Land zu lassen, die Neujahrsnacht in Köln, brennende Asylbewerberunterkünfte, mehrere islamistische Terroranschläge, die teils atemraubenden Wahlerfolge der AfD.
Die Welt sei aus den Fugen, hieß es, und sogar Deutschland, die Macht in der Mitte, schien plötzlich verunsichert. Das Lebensgefühl verschob sich, bekam etwas Beklommenes, bisweilen Hysterisches. Wut und Aggressivität wuchsen, die Zweifel auch: Zweifel an den Institutionen, Zweifel an den sogenannten Eliten, Zweifel an der Fähigkeit des Landes, die massenhaft neu dazugekommenen Menschen, die Flüchtlinge und Migranten, zu integrieren, mehr noch, ganz generell Zweifel an der Fähigkeit, unter steigendem Außendruck die innere Balance zu halten.
Und nun, zwei Jahre später, kurz vor der Bundestagswahl? Wie steht es um die politisch-seelische Verfassung der Republik?
Um das zu ergründen, hat das Bonner infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft im Auftrag der ZEIT eine repräsentativ ausgewählte Gruppe von 1.501 Bürgern befragt. Die Ergebnisse sind, vorsichtig gesagt, erstaunlich: Es zeigt sich das Bild eines Landes, das die Krisen bislang recht gelassen abgewettert hat. Keine Spur von innerer Spaltung, von grassierender Fremdenangst oder massiven Selbstzweifeln, im Gegenteil. In den von infas erhobenen Zahlen spiegelt sich eine Gesellschaft, die in ihrer großen Mehrheit weltoffen ist, tolerant und liberal.
Deutlich wird dies zunächst, wenn man danach fragt, ob es so etwas wie ein "Wir-Gefühl" im Lande gibt, ein Bewusstsein von Nähe, Solidarität und Gemeinschaft. Eine deutliche Mehrheit der Befragten, 56 Prozent, hält das für wichtig, noch mehr, 65 Prozent, wünschen sich ausdrücklich, das Wirgefühl solle in Zukunft noch wichtiger werden. Anders gesagt, die Bürger wollen nicht isoliert leben, sie verstehen sich als soziale Wesen.
Das "Wir", das zeigen die Ergebnisse, wird im Wesentlichen durch räumliche und persönliche Nähe konstituiert (Grafik 1): Wenn von "Wir" gesprochen wird, dann ist damit vor allem die eigene Familie gemeint (92 Prozent) und der Freundes- und Bekanntenkreis (91 Prozent), gleich darauf aber folgt bereits mit 78 Prozent "mein Heimatland Deutschland". 76 Prozent der Befragten nannten auf die Frage, wer zum "Wir" gehört, "mein Wohnort", 72 Prozent "meine Nachbarschaft", 68 Prozent "mein Bundesland" und genauso viele "Europa".
Angesichts der Debatten der vergangenen Monate mehr als überraschend waren die Antworten auf die Frage, welche Personengruppen nach Ansicht der Befragten nicht zum "Wir" dazugehören. Wie inklusiv ist das deutsche "Wir" im Spätsommer 2017? Konkret: Wer ist vom "Wir" ausgeschlossen? (Grafik 2)
Viel inklusiver kann eine Gesellschaft kaum sein
Trotz mehrerer islamistischer Anschläge, trotz aller Debatten um den Islam und seine Zugehörigkeit zu Deutschland, trotz der zunehmenden Entfremdung von der Türkei sagen 82 Prozent der Befragten, "Menschen anderer Religionen" gehörten zum "Wir" dazu. Ebenso "Homosexuelle" (80 Prozent), "Menschen mit einem ganz anderen Lebensstil" (73 Prozent), "Ausländer/Migranten" (72 Prozent). Und sogar jene Gruppe von Menschen, die die kollektive Psyche heftig bewegt hat, wird von fast drei Vierteln zum "Wir" gezählt: 71 Prozent der Befragten sagen, "Flüchtlinge" gehörten zum "Wir" dazu.
Es sind Zahlen, die eher aus den Hochzeiten der "Willkommenskultur" 2015 zu stammen scheinen als aus dem Spätsommer 2017. Viel inklusiver kann eine Gesellschaft kaum sein.
Dieser Befund deckt sich mit anderen Aussagen, die infas erhoben hat. So waren zwei Drittel der Befragten, 66 Prozent, der Auffassung, es sei "wichtig, sozial Benachteiligten und gesellschaftlichen Randgruppen zu helfen" (Grafik 4). 52 Prozent stimmten der These zu, "ohne Freihandel und internationale Zusammenarbeit gibt es keinen Wohlstand und Frieden" – eine Position, die von Rechtspopulisten in aller Welt heftig bestritten wird. Und ebenso viele der Interviewten, 52 Prozent, sagten, "man sollte immer auch Meinungen tolerieren, denen man eigentlich nicht zustimmen kann".
Menno Smid, Geschäftsführer von infas, sieht in diesen Befunden eine hohe "Zustimmung zu Aussagen des kosmopolitischen Liberalismus". Genauer: Nach Einschätzung des Sozialwissenschaftlers weisen rund 67 Prozent der Deutschen "eine Affinität" zum kosmopolitischen Liberalismus auf. Dabei handelt es sich allerdings eher um gesellschaftspolitische Grundeinstellungen, weniger um eine Nähe zu ökonomischen Vorstellungen des klassischen Liberalismus. Der Aussage etwa, "der Staat kontrolliert viel zu viele Bereiche unseres täglichen Lebens", eine häufig zitierte Begründung für die Forderung nach mehr Staatsferne und Deregulierung, stimmen nur 32 Prozent der Bürger zu (Grafik 5). Mit anderen Worten: Deutschland ist offen und tolerant, aber nicht regulierungskritisch oder gar staatsfeindlich.
Diese weitverbreitete Haltung ist allerdings nicht ohne Gegenpol. Eine relativ klar umrissene Gruppe von Bürgern vertritt entschieden andere Ansichten (Grafik 3). Auf die Frage, ob Flüchtlinge zum "Wir" in Deutschland dazugehören, sagen 80 Prozent der AfD-Anhänger klar "Nein", bei den Anhängern der anderen Parteien sind es zwischen 15 (Grüne) und 25 Prozent (FDP). Ähnlich sieht es bei der Frage aus, ob "Ausländer/Migranten" dazugehören: 75 Prozent der AfD-Anhänger sagen "Nein", bei den anderen Parteien sind es nur zwischen 5 (Grüne) und 26 Prozent (CDU). Weniger ablehnend stehen AfD-Anhänger interessanterweise einer anderen Gruppe gegenüber: Lediglich 36 Prozent von ihnen sagen, "Menschen anderer Religion" gehören nicht zum "Wir" – bei den Anhängern anderer Parteien liegt die Ablehnung allerdings noch erheblich niedriger, sie reicht von 3 Prozent (Grüne) bis zu 17 Prozent (SPD).
Aus welchen Quellen speist sich der Rechtspopulismus?
Nach den Erhebungen der Sozialwissenschaftler von infas lässt sich bei etwa 5 Prozent der Bevölkerung "starke Zustimmung" zu rechtspopulistischen Denkmustern feststellen. Weitere 18 Prozent zeigen eine Affinität zu dieser Ideologie, allerdings in unterschiedlicher Intensität. Laut Menno Smid von infas könne man allerdings "definitiv nicht sagen", diese insgesamt 23 Prozent der Deutschen seien allesamt potenzielle Wähler der AfD. Eine Affinität zu manchen rechtspopulistischen Thesen gebe es auch bei Wählern anderer Parteien.
Heftig ist in den vergangenen Jahren darüber gestritten worden, aus welchen Quellen sich der Rechtspopulismus speist, was genau seine Anhänger in Opposition zur liberalen Mehrheitsgesellschaft treibt. Sind es eher soziostrukturelle Faktoren? Oder kulturelle? Auch dieser Frage ist infas nachgegangen.
Dabei zeigt sich, dass für rechtspopulistisches Denken Bildung, eine spezifische Lebenslage und das Gefühl, nicht von der Politik vertreten zu werden, bestimmend sind (Grafik 6): Bei der Gruppe der Bevölkerung, die nach Erkenntnissen von infas rechtspopulistischen Positionen anhängt oder zuneigt, sind niedrige oder mittlere Schulabschlüsse dominierend. Die Lebenslage dieser Gruppe beschreiben die Sozialwissenschaftler eher als unsicher und prekär, wobei "Lebenslage" eine empirische Maßeinheit darstellt, in die Angaben zum Einkommen, zum Lebensstandard und zum Gefühl sozialer Zugehörigkeit einfließen.
Hinzu kommt ein dritter Faktor: Anhänger rechtspopulistischer Positionen fühlen sich durch "die Politik" nicht oder allenfalls schlecht vertreten. Diese Gruppe kennzeichnet zum Beispiel eine hohe Zustimmung zu der Aussage "Die etablierten Parteien und die Regierung kümmern sich nicht um Leute wie mich".
Überträgt man diese Erkenntnisse in ein Schaubild (Grafik 7), dann zeigt sich deutlich, wie weit die Einschätzungen der AfD-Anhänger zur eigenen Lebenslage und zur Vertretung durch die Politik von den Selbsteinschätzungen der Anhänger anderer Parteien abweichen. Die AfD-Anhänger haben einen eher niedrigen Lebenslagenindex und fühlen sich von der Politik kaum bis gar nicht vertreten – im extremen Gegensatz zum Beispiel zu den Anhängern der Grünen, die sich politisch recht gut vertreten fühlen und beim Lebenslagenindex fast im oberen Drittel rangieren, also im Durchschnitt wohlsituiert und etabliert sind.
Die Grafik macht auch anschaulich, wie nah beieinander die übrigen Parteien in dieser Hinsicht sind. Die Anhänger von SPD, FDP, CDU und Grünen liegen im Lebenslagenindex recht dicht zusammen, sie unterscheiden sich auch beim Gefühl der politischen Repräsentation nur marginal.
Auch das mag zum Eindruck der großen Stabilität kurz vor der Bundestagswahl 2017 beitragen, den die infas-Studie für die ZEIT insgesamt vermittelt. Und umgekehrt ist es Teil der Erklärung, warum dieser Wahlkampf bislang so wenig polarisiert: Eine der wichtigsten Konfliktlinien verläuft nicht zwischen den großen Parteien, zwischen links und rechts, sondern zwischen der liberalen Mehrheitsgesellschaft und einer rechtspopulistischen Minderheit.
Über die Unsicherheiten von Umfragen
Repräsentative Umfragen unterliegen immer Fehlern. Man kann davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bereich von einem bis drei Prozentpunkten über oder unter den letztlich angegebenen Messwerten liegt. Den Korridor dieses statistischen Fehlers zeigen wir ab sofort in unseren Grafiken zu Wahlumfragen.
Die Ergebnisse basieren immer auf Stichprobenbefragungen. Diese decken in der Regel nur spezielle Teile der Bevölkerung ab (z.B. Menschen mit Festnetz-Telefonanschluss oder Internetnutzer). Einige potenzielle Teilnehmer sind ablehnend und wollen erst gar nicht befragt werden. Fragen werden mitunter auch falsch verstanden und nicht immer aufrichtig beantwortet. Zum Beispiel auch in Reaktion auf vorangegangene Umfragen. Um jedoch ein allgemeines Meinungsbild über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu berechnen, müssen die Demoskopen fehlende Messwerte und vermutete Ungenauigkeiten ausgleichen und die vorliegenden Zahlen neu gewichten. Diese (in der Regel nicht transparenten) Formeln unterscheiden sich in den Instituten und führen daher zu unterschiedlichen Aussagen.
Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Mehr als eine grobe Tendenz für ein Meinungsbild lässt sich daraus nicht ableiten. Selbst wenn die Aussagen und Berechnungen zum Veröffentlichungszeitpunkt der Umfrage nahe an der Realität liegen, ist immer noch offen, ob die damals befragten Wähler zum Beispiel später tatsächlich ihre Stimme abgeben oder sich kurzfristig umentscheiden.