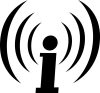Helma Orosz in ihrem letzten Interview als Oberbürgermeisterin Dresdens zu Pegida, Erinnerungskultur und ihren Zukunftsplänen
Dresden. Heute Nachmittag wird Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) im
Dresdner Rathaus aus dem Amt verabschiedet. Lange hatten es die Spatzen
schon von den Dächern gepfiffen, im Januar machte die OB ihren
Entschluss öffentlich: Sie tritt nicht zur Wiederwahl an, sondern
verlässt die politische Bühne vorzeitig. Nach einer schweren
Krebserkrankung reichte die Kraft nicht mehr, um ihren Ansprüchen an
sich selbst zu genügen, begründete die 61-Jährige ihre Entscheidung. In
ihrem letzten Interview als Oberbürgermeisterin verrät Helma Orosz, wie
sie die Zukunft ohne Politik plant.
Was geht in Ihnen vor - Wehmut oder eher das Gefühl, eine Last zu verlieren?
Das ist nicht immer gleich. Den einen Tag überwiegt etwas die Wehmut,
den anderen Tag weniger. Grundsätzlich war es für mich eine Befreiung,
als ich meine Entscheidung öffentlich gemacht habe. Solange ich den
Entschluss mit mir herumgetragen habe, war es eine Last. Als es dann
heraus war, hat das zusätzliche Kräfte mobilisiert. Viele Dinge wollte
ich noch auf den Weg bringen - wie zum Beispiel die Bewerbung für die
Kulturhauptstadt.
Warum hat es nicht mehr bis zur Wahl im Juni gereicht? Warum treten Sie schon jetzt ab?
Zum Ende des vergangenen Jahres war es schwieriger geworden mit meinen
gesundheitlichen Problemen. Es gab eine klare Ansage der Ärzte. Ich
wollte nicht mehr während des Wahlkampfes im Amt sein. Wahlkampf ist mit
besonderem Trubel verbunden, das wollte ich mir nicht antun. Der 70.
Jahrestag der Zerstörung Dresdens war mir aber sehr wichtig und deshalb
habe ich den Zeitpunkt so gewählt. Wir können gemeinsam stolz darauf
sein, wie gut dieser Jahrestag organisiert war und abgelaufen ist.
Wann haben Sie für sich entschieden, dass es nicht mehr geht?
Ich habe immer wieder überlegt. Ein über Jahre erhaltener
Vertrauensbeweis der Bürgerschaft ist etwas ganz Besonderes. Ich habe
deshalb den Entschluss lange hinausgezögert. Über ein halbes Jahr habe
ich mich immer wieder gefragt: Kann ich die Erwartungen erfüllen? Ich
bin ein agiler Typ, eine Kämpfernatur. Aber die Kraft reichte einfach
nicht mehr.
Gab es einen konkreten Auslöser für Ihren Entschluss?
Nachdem ich im Frühjahr 2012 von der Krankheit zurückgekehrt bin, war
für mich klar: Jetzt musst du unbedingt wieder arbeiten. Nach anderthalb
Jahren, Ende 2013, habe ich die Auswirkungen der Erkrankung immer mehr
gespürt. Den Stress können sie nicht abstellen in diesem Amt. Das ist
eine Dauerbelastung. Dazu kamen Schlafstörungen. Das ist der Hammer,
wenn man nach 12 bis 14 Stunden Arbeit keinen Schlaf findet. Da geht
einem die Puste aus. Ich musste mir oft sagen: Reiß dich zusammen! Aber
es kostet viel Kraft, sich zu verstellen. Andererseits habe ich in der
Kur schon nach drei, vier Tagen gemerkt, dass ich zur Ruhe gekommen bin.
Stille, Spaziergänge, Behandlungen, das gab mir die Mög- lichkeit,
wieder meinen Rhythmus zu finden.
Haben Sie Angst, jetzt in ein Loch zu fallen?
Ich bin mit mir absolut im Reinen. Meine Familie freut sich, meine
Enkel freuen sich. Die nächsten drei, vier Monate wird es gar nicht so
einfach, eine Lücke in meinem Terminkalender zu finden. 25 Jahre lang
war das Privatleben im einstelligen Bereich. Ich habe meine Familie
immer wieder vertröstet. Urlaub, Wandern, Fahrrad fahren - wann war das
möglich? Ich kann mir für die Zukunft nicht vorstellen, dass ich im
Sessel sitze und mich be- daure. Es gibt keine problematische Stimmung
in mir. Ich gehe so gerne ins Kino und ins Theater, darauf musste ich
oft verzichten. Ich habe so viele Ausstellungen eröffnet, ohne sie mir
richtig anschauen zu können. Ich möchte die Kirchen in der Stadt
besuchen. Oder einfach mal nur an der Elbe sitzen. Einen schönen Platz
habe ich mir schon ausgesucht.
Sie haben den 13. Februar angesprochen. Ist es nach dem 70. Jahrestag Zeit für einen Schlussstrich unter das Gedenken?
Ich denke, es ist wichtig, dass jede Stadt Erinnerungskultur lebt. Als
ich 2008 gewählt wurde, gab es darüber unterschiedliche Auffassungen,
aber keine Gemeinsamkeit. Daraus ist die Arbeitsgruppe 13. Februar
entstanden. Die Besetzung ist ein Querschnitt der Gesellschaft.
Ursprünglich ging es darum, Konzepte gegen die Aufmärsche von
Rechtsextremen zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe hat ihren Beitrag dazu
geleistet, dass es im vergangenen und in diesem Jahr keine Aufmärsche an
dem Tag gab. Das ist ein kleiner Erfolg, den wir gemeinsam erreicht
haben. Es geht aber darum, nicht nur den 13. Februar zu betrachten,
sondern sich das gesamte Jahr mit dem Thema zu befassen. Wir haben
Programme wie den Lokalen Handlungsplan für Weltoffenheit und Toleranz
entwickelt, und der zeitweilige Ausschuss des Stadt- rates hat ein
Erinnerungskonzept erarbeitet. Es stellt auf alle Ereignisse ab, die zur
Geschichte der Stadt gehören. Erinnerungskultur ist nicht in Stein
gemeißelt und kann sich weiter entwickeln. Wir haben den 13. Februar in
der Arbeitsgruppe ausgewertet und überlegen, welche Dinge jetzt
angegangen werden sollen.
Wen wünschen Sie sich als Ihren Nachfolger im Amt?
Das wird in einer geheimen Wahl entschieden. Wichtig ist es mir, dass
viele Dresdner zur Wahl gehen. Wir haben es leider mit einer
Wahlmüdigkeit zu tun. Ändern kann ich aber nur dann etwas, wenn ich
wählen gehe. Und nicht, wenn ich meine latente Unzufriedenheit auf die
Straße trage.
Warum funktioniert Pegida ausgerechnet in Dresden?
Es gibt auf diese Frage wahrscheinlich keine allgemeingültige Antwort,
sondern zahlreiche verschiedene. In Dresden und der Region haben sich
Menschen gefunden, die mit Pegida einen Nerv getroffen haben. Dann hat
das Ganze eine unglaubliche Dynamik bekommen, vor allem in den Medien.
Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es Leute gibt, die sich nicht
mitgenommen fühlen, die am politischen Prozess nicht teilhaben können
oder wollen. Wir müssen ihnen jetzt deutlich machen, dass wir wissen
wollen, wo ihr Problem liegt. Nur im Dialog können wir etwas ändern.
Stadt und Land agieren gemeinsam und bieten Foren an. Sie sind auch eine
Chance für Verantwortungsträger, zuzuhören, Missverständnisse
aufzuklären und Probleme zu erkennen. Gleichzeitig müssen wir aber gegen
jede Form der Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit Position beziehen.
Wie werden Sie sich künftig in die Stadtpolitik einbringen?
Ich werde eine aktive Bürgerin bleiben und mich schon an der einen oder
anderen Diskussion beteiligen. Ich freue mich auch darauf, mal eine
Sitzung des Stadtrates zu besuchen. Als Gast natürlich.
Interview: Thomas Baumann-Hartwig